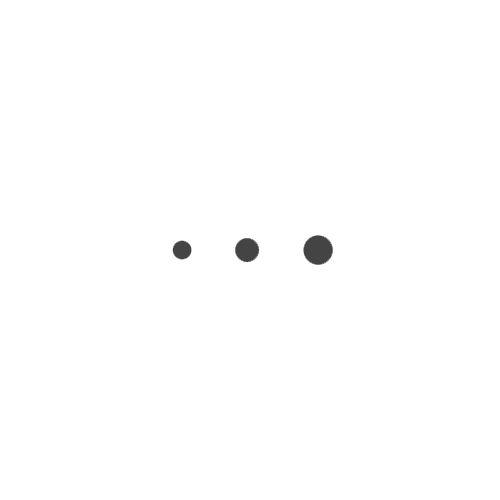(Die Sezessionskriege im zerfallenden Jugoslawien forderten insbesondere die Grünen heraus, die aus der Friedensbewegung entstanden waren und für eine neue friedliche Weltordnung stritten. Mit der Bombardierung Pales, des serbischen Hauptquartiers in Bosnien, griffen die USA und Nato-Verbündete zum ersten Mal militärisch ein. In der zugespitzten Diskussion versuchte ich als Mitglied des Auswärtigen Ausschusses am 31. August 1995 mit einem bisher unveröffentlichten grün-internen Policy-Paper einen neuen Weg zwischen Kaltem Krieg und Neuer Weltordnung, Interventionismus und Pazifismus zu skizzieren.)
Schon immer gab es zwei Linien in der grünen Friedens- und Sicherheitspolitik. Zusammengehalten wurden sie durch die Reflexionen auf Hitler-Faschismus, Holocaust und deutschen Angriffskrieg und durch die atomare Blocklogik mit der Unmöglichkeit, im Verteidigungsfalle die Gattung Mensch überleben zu lassen. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg – das war die gemeinsame Konsequenz. Die Unterschiede lagen in der Rolle des Militärs jenseits des atomaren Zeitalters. Die einen wollten eine Politik ohne jegliche Armee, die anderen plädierten für eine strukturelle Nichtangriffsfähigkeit als militärische Defensivstrategie. Beide Linien setzen sich in der heutigen Debatte um den Bosnienkrieg und seine Konsequenzen in gebrochener Form fort. Beide geraten in innere Widersprüche, die sie aber nicht selbst reflektieren, sondern sich von der Gegenseite als Mangel ankreiden lassen müssen.
Widersprüche der „Interventionisten“
Wer heute in grünen Kreisen militärische Optionen vertritt, kann dies nicht mehr mit der nötigen Landesverteidigung begründen. Es fehlt der potenzielle Angreifer. Verteidigt werden sollen heute materielle Güter wie fremde Territorien oder ideelle wie Menschenrechte, eine multikulturelle Gesellschaftsform oder die Glaubwürdigkeit des Westens. Dazu sind – und hier liegt ein Kernproblem – nicht Verteidigungs- sondern Angriffsmittel nötig. Wer Bomben auf Pale begrüßt, muss den Bau von angriffsfähigen Bombenflugzeugen fordern. Wer – sei es nur im Ausnahmefall, im worst case – schießen will, muss diese Ausnahmen denkend vorwegnehmen und gerüstet sein. Nicht oft kann er sich mit dem historischen Argument deutscher Kriegsverbrechen herauswinden, das für Ex-Jugoslawien gilt. Das aber heißt in der Konsequenz klipp und klar: wer Bomben und Bomber will, kann nicht mehr den neuen Eurofighter, die zugehörige Logistik und Rüstungsproduktion ablehnen. Er kann das Offensivkonzept einer schnellen Eingreiftruppe, damit den Kern von Rühes Militärpolitik und folglich auch den Rüstungshaushalt nicht mehr ablehnen. Jedenfalls nicht auf der Ebene der Reformalternativen, sondern nur noch auf der kleinlicher Krittelei. Es ist schlechterdings nicht möglich, Krisenintervention zu fordern, aber Kriseninterventionskräfte abzulehnen.
Die plötzliche Nähe zur traditionell-konservativen Militärpolitik zwingt dann oft zu radikaler Abgrenzungsrhetorik. Um den diskursiven Abstand zur CDU wieder herzustellen, wird ihr dämonisierend eine potenzielle Aggressivität in allen Weltregionen unterstellt, die einer genauen Analyse nicht standhält. Als ob es der Bundesregierung um schlimmeres ginge, als eine Großmacht vom Kaliber Frankreichs oder Englands zu werden. Der eigentliche Kritikmaßstab aber, nämlich dass genau dadurch die historischen Chancen, die das Ende der Blockkonfrontation real bietet, verspielt werden, geht so verloren. Denn irgendwie ist man ja selbst Bestandteil dieses militärgestützten westeuropäischen Großmachtdenkens geworden.
Damit aber verlieren die Grünen mehr als ihre Unschuld – nämlich die Reformfähigkeit überhaupt. Denn wir werden unweigerlich immer tiefer in den militärischen Machtdiskurs hineingezogen. Die falsche Lehre aus dem Bosnienkrieg könnte nämlich sein, dass es erst die Bomben waren, die den Frieden brachten. Damit würde als Grundmuster der Außenpolitik zementiert, was eigentlich zu bekämpfen ist: erst wegsehen, dann den Konflikt auf die eigenen nationalen Interessen umzulenken versuchen, dann Herumlavieren und wenn alles in Scherben liegt, massiv zuschlagen. Die zivilen Methoden würden weiterhin halbherzig praktiziert, auf der Checkliste für zivilisiertes Verhalten gleichsam der Reihe nach abgehakt, bis man endlich wieder Militär einsetzen kann. Das ist ja durch den Rüstungsetat längst bezahlt, während Wirtschaftssanktionen neues Geld kosten. Westeuropa kann auf die mittelalterlichen Atavisten in Serbien zeigen und den eigenen Zivilisationsmangel, der im hemmungslosen Geschäftchenmachen liegt, bestens kaschieren.
Dabei hat die westliche Wertegemeinschaft ihr Gesicht nicht dadurch verloren, dass sie zu spät Militär einsetzte, sondern dass sie von Beginn an nicht den Willen zu einer gemeinsamen Haltung in Ex-Jugoslawien aufbrachte. Das heißt auch: Europa ging nicht zum Teufel auf dem Balkan – sondern der Balkankonflikt zeigt, dass am „gemeinsamen“ Europa vieles Fiktion war. Die Gemeinsamkeit bezieht sich im Kern auf die Schaffung eines Raumes und von Spielregeln zur Verfolgung privater Geschäftsinteressen. Aber der Nationalstaat als politisches Aggregat privater Nutzenmaximierer hat noch nicht abgewirtschaftet.
Deshalb ist auch der Hinweis auf die Legitimation der Bomben durch die UNO nur formal richtig. Dass es überhaupt so weit kam, ist zum einen der verbrecherischen Politik der Serben geschuldet, aber auch der Wert-Losigkeit des westlichen Liberalismus. Wer jetzt die Bomben gutheißt, läuft Gefahr, die westliche Mentalität, die zu dieser fatalen Konsequenz führte, zu festigen. Das wäre das Ende jeder grünen Reformpolitik, die mehr will, als auf der Ebene des Verwaltungsvollzugs diesen oder jenen ökologischen Grenzwert zu verschärfen.
Die Bomben waren immanent folgerichtig im Rahmen einer von Beginn an falschen Politik. Aber stellen wir die Frage von Adorno: Gibt es das Richtige im Falschen? Wer nicht die Gesamtentwicklung des Jugoslawienkrieges im Auge hat, sondern sich auf die Bewertung des Ausschnittes einengen lässt, den uns die offiziöse Informationspolitik aufzwingen will, läuft in die Falle, nachträglich all das zu legitimieren, was von Beginn an falsch war. Oder es kommt zu beliebigen ex-post-Bewertungen. Da fordert jemand Militärschläge, ohne eine konkrete Vorstellung, wie dies geschehen solle. Fünf Wochen lang führt sich diese Forderung wegen der kroatischen Offensive ad absurdum. Plötzlich eine erneute Wende auf dem Gefechtsfeld, die zur Bombardierung führt und nun kann man sagen, das war es, was ich wollte. Wer so argumentiert, die Legitimation quasi aus dem „Kriegsglück“ bezieht und damit dem Militärischen nicht konzeptionell einen systematischen Ort zuweist, reduziert den Unterschied zu konservativer Militärpolitik auf Geschmacksfragen.
Dieser Artikel wird geschrieben, während die Bomben fallen. Wir wissen nicht, wie die Sache auf mittlere Sicht ausgeht. Generalisierende Bewertungen auf der Basis sich täglich ändernder Gefechtslagen sind unseriös. Die Interventionisten, die die Bomben bejubeln, haben vorab kein Wort darüber verloren, ob diese wirklich den politischen Durchbruch bringen würden. Immer deutlicher wird, dass der Angriff eher einem innenpolitischen Kalkül von Clinton entsprang und die Europäer zur Gesichtswahrung aufsprangen. Umfassende Konzepte für eine neue Ordnungspolitik auf dem Balkan, die über die Notlösung des Holbrook-Plan hinausgehen, haben sie nicht. Ebenso wenig eine Garantie für den Erfolg des Militärschlags oder Einschätzungen der Eskalationsgefahr. Und die Bomben machen vergessen, dass schon zuvor das Wirtschaftsembargo den Hauptschurken Milosevic weichgekocht und zum Einlenken gezwungen hatte.
In der umstandslosen Befürwortung der Bombardements zeigt sich ein falsches Verständnis vom Primat der Politik. Sie entscheidet ohne Reflexion auf die Risiken und die Militärs haben ihren Job zu tun, quasi als technische Assistenz. Technokratisches Funktionsdenken blendet das aus, was dem Krieg eigen ist, das Katastrophale, das Unerwartete, das Ungewollte, das Barbarische auch auf der Seite der „Guten“. Es entscheidet sich in kürzester Zeit, z.T. auf zufälliger Basis, ob hinterher behauptet werden darf, nur die Bomben haben den Frieden erzwungen, oder ob die NATO sich blamiert. Es wäre nun völlig pervers, letzteres zu erhoffen, um daraus für die pazifistische Seite Diskussionsvorteile zu gewinnen. Es ist zu hoffen, dass alles gutgeht. Es wäre aber ebenso vermessen, aus der Zufälligkeit eines guten Ausgangs nun die Systematik einer grünen militärgestützen Außenpolitik abzuleiten.
Die Reichweite von Interventionen ist ohnehin begrenzt. Einem Kleinstaat gegenüber sind sie nicht nötig. Einem Megastaat gegenüber nicht möglich. Grosny kann nicht durch die Interventionisten freigeschossen werden. Daran bricht sich jede Vorstellung militärflankierter Außenpolitik. Letztlich geht also nicht vorbei am mühsamen und mit furchtbaren Rückschlägen versehenen Weg der Völkerverständigung.
Widersprüche der „Pazifisten“
In der Bosnienfrage gab es eigentlich drei Strömungen. Denn bei den „Pazifisten“ gab es zwei Gruppen: die eine, die den Konfliktparteien lange neutral gegenüberstand und die andere, die die Serben für die Hauptverbrecher hielt und hier Berührungen mit den „Interventionisten“ hatte – dazu zähle ich mich persönlich; nur weil beide keine Intervention wollten, kamen sie zusammen. Aus dieser Differenz ergibt sich eine unterschiedliche Bewertung der Chancen von neutraler Vermittlung und hartem Druck.
Wie die traditionelle Außenpolitik hat auch die pazifistische noch kein Rezept, wie mit der völlig veränderten globalen Situation umzugehen sei. Für viele Pazifisten stehen die Forderungen im Vordergrund, die gegen die Blocklogik gemünzt waren. Es gibt die subtile Weigerung sich einzugestehen, dass die Welt eine völlig andere geworden ist. Dabei muss diese Erkenntnis nicht zu einer Aufgabe der antimilitaristischen Grundwerte führen. Aber es müsste die Offenheit da sein, eine schonungslose und differenzierte Beschreibung der neuen Sicherheits- und Bedrohungslage zu leisten. Im Vordergrund wird zurecht ein erweiterter Sicherheitsbegriff stehen, der Sicherheit nicht mehr einseitig militärisch definiert, sondern sozial und ökologisch und der die entsprechenden Forderungen nach einer globalen sozial-ökologischen Strukturpolitik aufwirft.
Aber diesem Pazifismus muss die Frage gestellt werden, ob er nicht seinerseits einseitig ist, wenn er nicht anerkennen will, dass ethnisch-nationalistische-tribalistische Konflikte vermehrt und barbarischer auftreten, weil sie nicht mehr durch die allgemeine Vernichtungsdrohung der Blockkonfrontation gezügelt werden. Den Interventionisten vorzuwerfen, sie schauten zwar auf Sarajewo, nicht aber auf Ruanda, wo viel mehr Menschen ermordet werden, ist einerseits richtig; es wird aber zum oberflächlichen Kampfargument, wenn man nicht selbst Konzepte vorstellt, wie denn Konflikte wie in Ruanda zu bearbeiten wären. Eine offene Diskussion würde schnell an die Grenzen des bisherigen pazifistischen Repertoires von Konfliktvermeidung, Schlichtung und Druck durch Wirtschaftssanktionen stoßen.
Die Grünen haben bisher friedenserhaltende Maßnahmen der UNO befürwortet, eine deutsche Beteiligung aber abgelehnt. Die Gründe dafür sind heute nicht mehr triftig. Das Verfassungsargument ist ausgeräumt. Dass die Bundeswehr nicht geeignet sei, kann auch positiv formuliert werden als Anforderung an eine eigens zu schaffende Einheit. Das historische Argument deutscher Kriegsschuld ist zwiespältig und träfe auf Ruanda z.B. nicht zu. Und die Befürchtung, deutsche Blauhelme seien Türöffner für eine Militarisierung der deutschen Außenpolitik, gälte ja wohl nicht für eine rot-grüne Regierung. Sich überhaupt heraushalten und andere Länder die schwierige Arbeit machen zu lassen, kann nicht angehen, wenn man zurecht die deutsche Einbindung in internationale Zusammenarbeit fordert. „Das Ausland“ hat keine Angst vor einem Deutschland, das Blauhelme stellt, wie eine Art pazifistischer Lebenslüge suggeriert. Von einem eingebundenen Deutschland wird erwartet, dass es sich an der politischen Lastenteilung beteiligt. Zu stark allerdings will man uns auch nicht sehen; nicht wie Frankreich oder England, die vielen eher als Schreckgespenster antiquierter Nationalstaaten gelten.
Neuen Rollen zuzustimmen, bedeutet deshalb gerade nicht Anpassung an die bestehenden Institutionen, wie das Teile der Öffentlichkeit von uns erwarten. Wir haben die Freiheit, für jede Veränderung der internationalen Institutionen einzutreten. Aber es ist ungeklärt, wie wir mit ungeliebten Organisationen umgehen, die wir nicht abschaffen können. Die NATO ist historisch überholt, wäre aber auch durch Beschluss einer rot-grünen Mehrheit nicht abschaffbar. Ein einseitiger Austritt ist nicht ratsam, weil er bei den Nachbarn die Angst vor einer eigenständigen deutschen Großmacht wiederbeleben würde. Ein ersatzloses Verschwinden der NATO wäre auch theoretisch nicht wünschenswert, weil dann die Gefahr eines Rückfalls in die Bismarck’sche Außenpolitik bestünde. Wenn Pazifisten sich nicht mit realitätstauglichen – d.h. nicht apriori mehrheitsfähigen – Konzepten zur Neuordnung der internationalen Organisationen zu Wort melden, überlassen sie den Konservativen das Feld.
Ausblick
Eine Weiterentwicklung grüner Friedenspolitik könnte auf der Basis bisheriger Grundorientierungen anhand folgender Eckpunkte diskutiert werden:
Die NATO, die wir für historisch überholt und hinderlich auf dem Weg zu Systemen kollektiver Sicherheit und einer ökologisch-solidarischen Weltwirtschaft halten, wird real nur in dem Maße an Einfluss verlieren, als andere Organisationen ihre offiziellen und faktischen Funktionen übernehmen. Die gehen praktisch über den reinen Verteidigungsauftrag hinaus. Sie bilden das Drohpotential für westliche Interessenpolitik, die sich so nicht mehr solidarisch mit anderen vermitteln muss. Diese abzulehnende Funktion wird ergänzt durch eine umstrittene, nämlich die militärischen Aufgaben im Rahmen der UNO. Immer stärker aber werden unerlässliche Aufgaben wie die Verständigung und Zusammenbindung ehemaliger WK-II-Feindstaaten auf zwei verschiedenen Kontinenten. Wenn wir zwischen Organisation und Funktionen, ihren positiven und negativen, zu unterscheiden lernen, werden wir für einzelne Funktionen andere Institutionen schaffen und die NATO damit auf ihren verteidigungspolitischen Kern begrenzen können, der über multilaterale Abrüstungspolitik weiter reduziert wird. Nicht Austritt oder Abschaffung ist also das Stichwort, sondern funktionale Differenzierung und Transformation. Die politischen Funktionen können zum einen durch einen neuen transatlantischen Grundlagenvertrag erfüllt werden, der Amerika mit Europa verknüpft. Zum anderen muss die OSZE zum zentralen Ost-West-übergreifenden Ort kollektiver Sicherheitspolitik werden.
Dies setzt aber eine entsprechende Ausstattung der OSZE voraus. Wenn sie als Regionalorganisation der UNO nicht in der Lage ist, Menschenrechte zu verteidigen, selbst friedenserhaltende Missionen zu entsenden oder auch mit hard power die Einhaltung von Wirtschaftssanktionen durchzusetzen, wird das traditionelle Militär nie suspendiert werden. Wenn die Nationalstaaten entwaffnet werden und gleichzeitig das NATO-Bündnissystem, das gegnerische Militärstrukturen voraussetzt oder provoziert, ersetzt werden soll, muss ein solcher Machtransfer auf die multilaterale Ebene stattfinden. Dann kann es auch keinen triftigen Grund gegen eine deutsche Beteiligung geben.
Solche Überlegungen scheinen mir das mindeste zu sein, was geleistet werden muss, wenn Antimilitarismus und Antifaschismus angesichts der neuen Weltlage neu vermittelt werden sollen. Wir sollten von uns aus offensiv nach neuen Antworten suchen und uns nicht an alte Gewissheiten klammern, die uns nur das fatale Selbstverständnis lassen, ständig im Abwehrkampf „gegen rechts“ zu stehen.