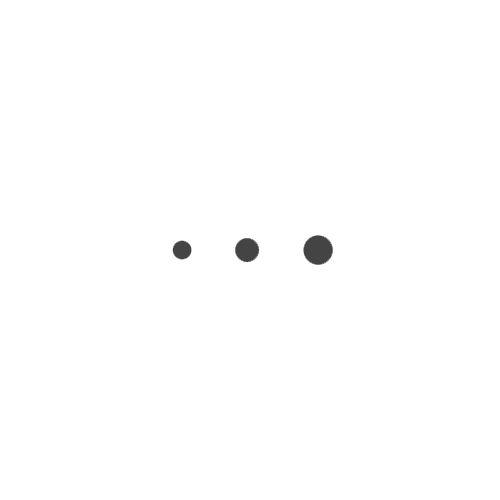Es gibt ein Leben nach den Grünen
Ein tiefes Loch, in das sie fallen, wird ausscheidenden Politikern gern prophezeit, die lange von echter oder eingebildeter Wichtigkeit gelebt haben. Das kann passieren, aber für mich tat sich kein Abgrund auf, sondern eine attraktive Collage aus Wissenschaft, Publizieren, Beraten, Sport, Reisen und einem renovierten Privatleben – ein Gefühl der Freiheit. Bald stand ich wieder auf hohen Bergen, auch wenn die Kondition nachließ. Meinen 60. Geburtstag beging ich auf den Klippen von Kap Hoorn, den 70. in der Antarktis. Doch ganz kommt ein Sozialwissenschaftler an der Politik nicht vorbei.
Wiedersehen
Der Abschied aus der aktiven Politik war beabsichtigt, die grün-internen Umstände jedoch waren äusserst unerfreulich gewesen. Ich hatte noch zu MdB-Zeiten begonnen, kleinere Beraterjobs als berufliche Rückversicherung anzunehmen. Ich wollte nicht auf ein Bundestagsmandat angewiesen sein. Es gab genügend KollegInnen, die sich an das Mandat klammerten, weil sie sonst nichts hatten. Grüne „Parteifreunde“ drehten mir einen Strick daraus, obwohl die geringen Honorare nicht einmal meldepflichtig nach dem Abgeordnetengesetz waren. Angebote von DAX-Unternehmen hatte ich übrigens ausgeschlagen. Dass der politische Gegner mich wegen des Vordringens in seine Wirtschaftswelt anfeindete, war zu erwarten; die doppelten Standards der Grünen hatte ich unterschätzt.
Deshalb ging ich auf Distanz, genoss Freiheit und Freizeit. Trotzdem gelang es nicht, mich ganz von der Partei zu lösen. Schuld war nicht zuletzt die Arbeit an den beiden Büchern zur grünen Geschichte. Grüne Meetings jeder Art aber mied ich sechs Jahre lang, bis ein Parteitag vor der Haustür die Entscheidung erzwang: endgültiger Bruch oder zumindest als Schlachtenbummler hingehen und Fühlung zu alten Freunden aufnehmen. Ich entschied mich für die zweite Variante. Grüner zu sein ist Schicksal.
Lehre und Forschung
Ab 2006 wurde ich am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin, dem berühmten „OSI“, für acht Jahre als Hochschullehrer für Internationale Beziehungen mit dem Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik tätig. Krisenprävention, zivile Konfliktbearbeitung, Krieg und Frieden waren meine Themen – in Theorie und Empirie, auf der Basis eigener Erfahrungen. Das Hauptseminar, eigentlich für wenige Spezialisten gedacht, begann jedes Semester mit 100 bis 150 Studies aus mindestens zehn verschiedenen Ländern und Kulturen. Ein wenig stolz darf ich darauf sein, dass spätere Europaabgeordnete, UNO-Beauftragte und andere Talente auch durch meine Schule gegangen sind. Eine anstehende Ernennung zum Honorar-Professor verstolperte die Uni-Bürokratie. Das war mir entschieden zu blöd, und so zog ich weiter.
Ein Gastvortrag führte zur Friedrich-Schiller-Universität Jena. Dort hatten drei führende Soziologien ein Mega-Forschungsprojekt zu „Post-Wachstums-Gesellschaften“ gestartet – „die Große Transformation“, das 2019 in einen Soziologenkongress mündete. Ich wurde eingeladen, als Senior Fellow internationale Perspektiven beisteuern, besonders die Frage der Migration und ihres makrosoziologischen Einflusses auf die künftige Gesellschaftsentwicklung. Auf diese Weise schloss sich ein biographischer Kreis: er hatte zu Jugendzeiten mit meiner Beteiligung an der „Kemnade“, einem multikulturellen „Gastarbeiter“-Fest in der gleichnamigen Burg im Ruhrgebiet, begonnen und mich über die Verweigerung, als angestellter Stadtplaner eine eine Ausländersiedlung plattzusanieren, in die Politik geführt.
Aufstehen für sozial-ökologische Neuansätze
Der Schwenk der Grünen zu einem Linksliberalismus, der die sozio-ökonomischen Voraussetzungen für einen mehrheitsfähigen Klimaschutz aus dem Auge verlor, bewegte mich immer wieder, Initiativen zu einer links-ökologischen Renaissance zu unterstützen. Grün-intern über den „Petra-Kelly-Kreis“ oder die „unabhängige Linke“, als Solist mit kritischen Essays, die ihre Leserschaft fanden, in den Augen der bündnisgrünen Parteiführung aber als Rentnerterror erschienen. Deshalb schloss ich mich auch dem „Institut solidarische Moderne (ISM)“ an, das einen Crossover-Diskurs von SPD, Linkspartei, Grünen und unabhängigen Linken zu organisieren suchte – ohne durchschlagenden Erfolg. Erwähnenswert ist auch der Berliner „Ossietzky-Kreis“ (der ehemalige „Pankower Friedenskreis“), der mich immer wieder einlud. Der links-sozialdemokratischen „Willy-Brandt-Kreis“ nahm mich als Mitglied auf. Trotz dieser Bezugspunkte fühlte ich mich mit den Jahren manchmal als „heimatloser Linker“, wie wir Undogmatischen uns Anfang der 1970er Jahre in West-Deutschland nannten.
In den 2010er Jahren galt es, nach dem Anschwellen des Rechtspopulismus Straße, Köpfe und Parlamente für eine engagierte sozial-ökologische Reformpolitik zurückzugewinnen. So beteiligte ich mich 2018 an der Gründung der Basisbewegung „Aufstehen“ und gehörte bald dem politischen Vorstand an. Bis zu 170.000 Menschen erklärten sich online zu Unterstützern. Leider wurde die Initiative schnell durch die Hauptinitiatorin Sarah Wagenknecht selbst sabotiert, weil sie „Aufstehen“ gegen mich und andere nicht zu einer kadermäßig organisierten links-konservativen Proto-Partei formieren konnte. Anfang 2019 erklärte mit mir der Vorstand „Aufstehen“ für gescheitert. Einige Aktivisten fanden über mich zu den Grünen.
Andere führende Köpfe bildeten einen Diskussionskreis, die „Gruppe Neubeginn“. Wir machten uns mit politischen Essays bemerkbar, bis auch dieser Ansatz wegen unüberwindbarer Differenzen in außen- und friedenspolitischen Fragen kollabierte – ein Fanal dafür, dass eine Grün-rot-rote Regierung bei der Bundestagswahl 2021 wohl außer Reichweite bleiben würde. 2024 schloss ich mich der „Bürgerbewegung Finanzwende“ an, welche die ungerechten und antiökologischen Auswirkungen des Finanz- und Geldwesens anprangert.
Renaissance und Neubeginn?
Ab 2019 konnten die Grünen die Zahl ihrer Mitglieder und Anhänger verdoppeln. Treibende Kraft war der Massenprotest von „Fridays for Future“ für eine radikalere Klimaschutzpolitik. Mitte der 1980er Jahre hatte ich selbst zu den wenigen politischen Pionieren gehört, die ökologische Verheerungen als Problem für das Weltklima zu begreifen begannen, erste Klimaschutzprogramme schrieben und im Bundestag thematisierten. Die neue Generation von AktivistInnen nun zwang die Grünen, ihre zwischenzeitlich „realpolitisch“ abgeschliffenen Programme wieder anzuschärfen. Mit dem Grundsatzprogramm von 2020 fand die Partei zu einigen ihrer Wurzeln zurück. Es enthält wieder, bis in den Wortlaut, Positionen, die ich vor Jahrzehnten mitformuliert hatte.
Die stark gestartete bündnisgrüne Kampagne für die Bundestagswahl 2021 aber geriet wegen biographischer Fakes, Strategie- und Kommunikationsfehlern der Führungscrew, links-identitärer Übertreibungen und der verstörenden Message „Klimapolitik ist der allerwichtigste Punkt – außer dem grünen Frauenstatut“ außer Tritt. Dennoch, die entscheidende Frage lautete: Wollen wir wegen Fehlern in der grünen Wahlkampagne Parteien an die Macht lassen, die uns immer tiefer in die Klimakatastrophe treiben? Das alles entscheidende Thema der nächsten Jahrzehnte bleibt das Überleben der Menschheit auf dem Planeten Erde, die Klima- und Ökologiefrage, verbunden mit der nach sozialem Ausgleich und Frieden. Dem gegenüber verblassen alle anderen Fragen. Eigentlich.
Die Realität aber zeigt: die konservative Massenträgheit der Bevölkerung hat fatale Auswirkungen. Das grüne Wahlergebnis war ernüchternd, gemessen daran, was möglich war und mehr noch, was nötig wäre. Der Koalitionsvertrag und die Regierungspraxis der „Ampel“ blieben weit hinter den klimapolitischen Notwendigkeiten zurück. Zu stark waren die Beharrungskräfte der „Partner“: einer eigentlich abgewirtschafteten Partei des Weiterso, welche die Wucht der heraufziehenden Klimakatastrophe nicht ansatzweise begreift und deren Mehrheit die Menschen vor dem Klima schützen will statt umgekehrt. Zudem die Chuzpe der Porschefahrer-Partei, welcher die Gesellschaft die stärkste soziale Spaltung unter allen Wirtschaftsnationen zu verdanken hat und die nur wegen ihrer nassforschen Anbiederei bei „Querdenkern“ im Zuge von „Corona“ reüssierte. Diese Gefechtslage motivierte mich zu der einzigen Teilnahme an einer grün-internen Abstimmung nach meinem Ausscheiden aus dem Bundestag: bei der Urabstimmung über diese Koalition habe ich mit „nein“ gestimmt.
Die verschnarchten Vorgängerregierungen aus CDU/CSU, SPD und FDP haben systematisch in die klimapolitische Sackgasse geführt, die Infrastruktur ruiniert und überfällige Modernisierungen etwa bei der Digitalisierung verschlafen. Nun verhindern SPD und FDP die notwendige Wende in der „Ampel“. In die Schuhe geschoben wird das Desaster öffentlich den Grünen. Die „Fortschrittskoalition“ aus „neuer“ und „alter Mitte“ erweist sich als Illusion. Das Parteienbündnis von Aufsteigern und Arrivierten packt zudem das strukturelle Problem von ungerechter Verteilung von Macht, Eigentum und Lebenschancen nicht wirklich an – eine Voraussetzung für eine effiziente Klimapolitik. Der Überfall von Putins Russland auf die Ukraine tut ein Übriges: das gesamte politische Koordinatensystem ändert sich – nicht zum guten. Ohne die „Straße“, ohne eine starke Massenbewegung wird es die überfällige ökologische Wende, wird es Klima-, Arten- und Menschenschutz nicht geben.
UND: Bei aller Kritik an den Grünen – gegen die gewaltsamen Übergriffe von Rechtsextremisten, die Schmähungen durch die rechtspopulistische CSU, die Sabotagepolitik der FDP und gegen die klammheimliche Freude der SPD muss man die Partei in Schutz nehmen. Letztlich ist und bleibt sie die einzige Hoffnungsträgerin für diese Gesellschaft und ihr Überleben auf dem Planeten.
Die Zukunft liegt auf dem Wasser.