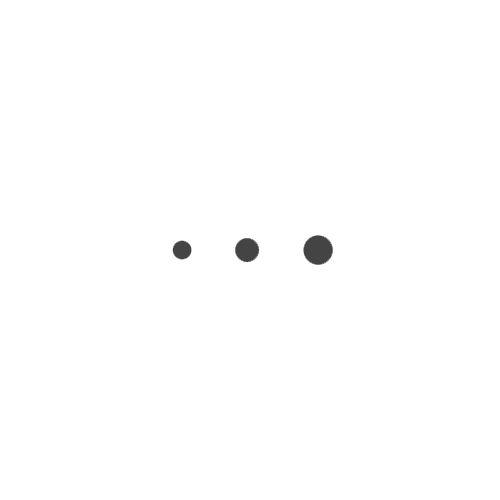(Vor 50 Jahren putschten Militärs, unterstützt von der US-Regierung und wirtschaftsliberalen Ökonomen, den gewählten Präsidenten Chiles weg. Es folgten Jahre brutaler faschistischer Unterdrückung mit Tausenden von Mordopfern. Die Förderung von Militärdiktaturen durch die USA und deren Billigung durch Europa bildet einen der Hintergründe dafür, dass südamerikanische Demokratien dem Westen heute die Solidarität mit der von Russland überfallenen Ukraine verweigern und ins BRICS-Lager wechseln. Zum Putsch in Chile und der Wiedergewinnung der Demokratie habe ich ein (autobiographisches) Kapitel in meinem Buch „Kriegsgeschrei“ geschrieben. Es ist hier gekürzt abgedruckt)
Moneda und Zwiebelfisch
(Zur Befreiung Chiles von der Militärdiktatur)
„Kann ich mal Dein Telefon benutzen?“ Der Journalist steht wieder in der Tür. Exilchilene, ein Senor, groß, wallendes Haupthaar, verwegen geschwungener Schnäuzer. Er kommt fast jede Woche, um über das Telefon im Abgeordnetenbüro seine Morgensendung für Radio Catolica in Santiago de Chile abzusetzen. Er hat Engagement, aber kein Geld für eine Studiomiete. „Weißt Du“, erläutert er einmal, „ein Kirchensender hat noch ein wenig Freiheit unter der Diktatur, und über dein Telefon kann ich regimekritische Botschaften verbreiten.“ Mitte der 1980er Jahre. Seine Informationen aus dem demokratischen Europa unterstützen die Opposition. Andere Exilchilenen nutzen unser Büro hin und wieder, um europaweit ihre Aktivitäten zu koordinieren. Widerstand gegen das Pinochet-Regime.
1973 hatte sich General Augusto Pinochet, unterstützt von CIA, US-amerikanischen Konzernen, lokalen Transportunternehmen und den marktradikalen Ideologen der Chicago-Schule, gegen den gewählten sozialistischen Präsidenten Salvador Allende blutig an die Macht geputscht. Seine Luftwaffe hatte den Amtssitz des Präsidenten, die Moneda, bombardiert, Allende war dabei umgekommen. Tausende seiner Anhänger waren ermordet worden, noch mehr einfach verschwunden, Oppositionelle wurden systematisch terrorisiert und gefoltert. Doch der Widerstand lebte. Auch grüne Parteifreunde, einst aus Chile geflohen, engagierten sich offen oder subversiv in der Opposition. Die Vernetzung über grüne Parlamentstelefone erweiterte ihre Handlungsmöglichkeiten über die Infrastruktur der Sozialistischen Internationalen hinaus. Sie waren maßgeblich beteiligt, einen „internationalen Parlamentarierkongress zur Wiedereinführung der Demokratie in Chile“ im Untergrund zu organisieren, der offen besucht werden sollte von Abgeordneten aus aller Welt.
September 1987. Auch aus dem Bundestag reiste eine Delegation an; SPD-Mann Freimut Duve, ein Vertreter der FDP, ich war für die Grünen dabei, CDU/CSU fehlten. Anflug auf Chile. Lufthansa, erste Klasse, feiner Service, Andenquerung, spektakulärer Vorbeiflug an der eisverkrusteten Südwand des Aconcagua, des höchsten Bergs der westlichen Halbkugel, im Norden die anderen Riesen-Vulkane, legendäre Orte für einen Bergsteiger, steiler Landeanflug, unter uns das braune, geschwungene Hochland des Altiplano, in Sicht der Pazifik, ein wunderbarer Flug, Landung in Santiago. Aussteigen. Diktatur.
Die deutsche Botschaft empfing uns reserviert. Ärger konnte sie nicht gebrauchen. Man müsse sich hier arrangieren. So der Tenor des Botschafters, schmissiger Konservativer der alten Schule. Doch nun saßen wir Abgeordneten aus aller Welt im Saal eines kleinen Hotels im Zentrum von Santiago, hielten Reden gegen das Regime, für Demokratie und Menschenrechte. Geschützt von Oppositionellen, die das Treppenhaus derartig mit ihren Leibern verstopften, dass Pinochets Militärpolizei, die das Viertel umstellt hatte, nicht hineinkommen konnte. Heimlich wurde sogar der sozialistische Spitzenpolitiker Ricardo Lagos aus dem Exil eingeschmuggelt, um unter Lebensgefahr zu demonstrieren, dass das Regime zu schlagen war. Noch war nicht zu ahnen, dass er zwölf Jahre später als frei gewählter Präsident Bundeskanzler Schröder und mir in Berlin gegenübersitzen würde.
Mittagspause. Ich möchte eine Runde um den Block machen, begleitet von meiner tapferen Dolmetscherin, einer Deutschen, deren chilenischer Mann wegen Widerstandes im Gefängnis sitzt. „Stehen bleiben! Film her!“ Plötzlich werden wir verhaftet. Ich habe an einer Straßenkreuzung mit einer Minox-Kamera Fotos von Militärfahrzeugen gemacht, die deutsche Markenzeichen tragen. Nicht bemerkt habe ich den Geheimpolizisten auf unseren Fersen. Wir werden umzingelt. Sie wissen nicht, wo die Minox steckt, das flache Ding zeichnet sich in meiner Sakkotasche nicht ab. Mir ist mulmig, aber sie trauen sich nicht, mich anzurühren. Stattdessen durchsuchen sie meine Begleiterin. Vergeblich. Wir werden in einen Bus gedrängt. Schwer bewaffnete Militärpolizei. „Rücken Sie den Film heraus!“ Ich lasse durch die Dolmetscherin ausrichten, dass ich nicht bereit sei, mit ihnen überhaupt nur zu reden. Abgeordnete genössen diplomatische Immunität, und man solle uns sofort freilassen. Lange geht es hin und her. Sie lassen uns warten, telefonieren, gehen uns wieder an. Sie werden nervös. Irgendwann sind wir frei. Den Film haben sie nicht bekommen. Der Kongress hatte uns vermisst, die Verhaftung sich herumgesprochen, die Militärs befürchteten einen großen internationalen Eklat. Die Opposition feiert unsere Freilassung wie einen Sieg. Ein kleiner Erfolg, der Mut macht.
Bei Dunkelheit fahren Freunde Freimut Duve, mich und einen Abgeordneten aus Uruguay, einen ehemaligen Untergrundkämpfer der Tupamaros, in eine abgelegene Fabrik. Düsteres Gebäude, außen kein Licht. Eine Tür geht auf. Drinnen hunderte von Jugendlichen. Ein konspirativer Kongress oppositioneller Jugendorganisationen. Wir halten Solidaritätsreden. Duve muss schnell wieder weg, ich bleibe länger. Plötzlich kommt der Versammlungsleiter, ruhig, ernst, flüstert: „Das gesamte Gelände ist von Militär umstellt!“
Die Veranstalter sind sehr besorgt. Das ist kein Spaß. Wie kann man hier heil herauskommen? Mancher der Anwesenden spricht von Kampf. Der Leiter, ein Funktionär der kommunistischen Jugend, ist besonnen und will verhandeln. Er bittet den Kollegen aus Uruguay und mich zu bleiben. „Wenn ihr jetzt geht…nicht auszudenken, was passiert.“ Er geht raus zum Militär: „Wir haben zwei ausländische Abgeordnete bei uns.“ Die Einigung: die Versammlung wird aufgelöst bei Zusicherung freien Geleits. Wir Abgeordneten sollen die Szene beobachten. Und so stehen der ehemalige Tupamaro und der grüne Abgeordnete am Fabriktor und beobachten eine gespenstische Szene. Welch ein Unterschied zum Gerangel zwischen Polizei und Demonstranten in Deutschland! Bei uns oft ein Räuber- und Gendarm- Spiel, mit sportlichen Zügen, oft unfair, oft grob, nur selten lebensgefährlich. Aber hier? Auf der Straße Militär mit Maschinenpistolen und Gaskampfwagen, made in Germany. Aus dem Fabrikgebäude kommen, immer zu zweit, Hand in Hand, schweigend die Jugendlichen. Keiner macht eine dumme Bemerkung. Keiner provoziert „die Bullen“. Hier muss kein Polizist auf die Verhältnismäßigkeit der Mittel achten. In einer Militärdiktatur gibt es nur brutal durchgesetzte Herrschaft. In äußerster Disziplin wird angesichts schussbereiter Waffen evakuiert. Nach einer halben Stunde ist der Spuk vorbei. Irgendwie komme ich ins Hotel zurück.
Der Bonner Journalist aus der Eingangsszene, der auf Kosten der grünen Fraktion mitreisen konnte und unseren Besuch vorbereitete, organisiert ein Pressegespräch im Untergrund. Manch ein Schreiber traut sich, Kritisches zu berichten, wenn es von Ausländern stammt. Nicht alle in Deutschland sind für die Diktatur, mache ich deutlich; selbst Konservative gehen auf Distanz. Pinochet wird die Unterstützung des Westens verlieren! Danach ein langes Gespräch mit einer führenden Vertreterin der illegalen Frauenbewegung. Sie hat bei Marcuse in Berkeley studiert, war Aktivistin der antiautoritären Studentenbewegung in den USA, hat für Emanzipation gekämpft, für die Befreiung kultureller Bedürfnisse aus den Fängen des Spießertums – sie ging zurück in ihr Heimatland und erzählt mir nun, wie Verelendung aussieht, die Verelendung der Intellektuellen, die an Emanzipation und Aufklärung gearbeitet hatten und nun – so sie nicht ermordet wurden – der totalitären Kontrolle durch ein faschistisches Regime und militaristische Machos unterworfen sind. Die alles vergessen sollen, was sie gesehen, studiert und erhofft hatten. Ein bedrückender Kontrast zur anarchischen Lebensfreude und provokativen Expressivität, die wir Grünen gerade in die deutsche Politik tragen. Tief in der Nacht schleiche ich allein zurück zum Hotel.
Am nächsten Tag Abflug. Lufthansa, erste Klasse, exzellenter Service, traumhafter Anflug auf Rio…welch bizarre Woche! Einmal Diktatur hin und zurück, erster Klasse, bitte. Die schizoide Realität von Außenpolitikern. Im Sitz neben mir die liebenswürdige Gattin eines deutschen Bankers: „Gut, dass wir Pinochet haben. Der hat für Ruhe und Ordnung gesorgt.“ „Es herrscht Ruhe im Land“, denke ich, „so hieß Peter Lilienthals Film über Pinochets Massaker?“[i]
2001, viele Jahre später wurde Pinochet der Prozess gemacht. Die spanische Justiz, selbst noch nicht lange einer Militärdiktatur entronnen, nahm sich die Freiheit der Anklage, was ich im Namen der Bundesregierung begrüßte. Der Verbrecher entkam ihr durch sein Ableben. Die Parlamentarierversammlungen hatten zum Ende seines Regimes beigetragen, sie hatten der mutigen chilenischen Opposition Rückendeckung der internationalen Öffentlichkeit gegeben.
Anfang Oktober 1988. Die zweite Versammlung. Es sollten historische Tage werden, die Tage von Pinochets entscheidender Niederlage. 1980 hatten CSU-nahe deutsche Juristen eine Verfassung für Pinochet ausgearbeitet, die bei dem Anschein demokratischer Elemente langfristig die Herrschaft des Diktators sichern sollte. Für 1988, acht Jahre später und 15 Jahre nach dem Putsch, sollte ein Referendum über eine weitere achtjährige Amtszeit stattfinden. Der Diktator hatte sich nun durch den internationalen Druck gezwungen gesehen, dieses Referendum tatsächlich durchzuführen. Eigentlich nur eine Scheinlegitimation. Zudem gingen die Pinochetistas von einem klaren Sieg aus – ihre Machtausübung würde reichen, dem Volk ein „Si“ abzupressen. Das Plebiszit war umstritten unter den Oppositionellen; auch ein „No“ entmachtete den Diktator nicht wirklich. Er bliebe noch ein Jahr im Amt, danach Senator auf Lebenszeit, Oberkommandierender der Armee und auf ewig immun gegen juristische Verfolgung. Die Teilnahme am Plebiszit aber verpflichtete den Widerstand auf einen Weg nach den Spielregeln des Despoten. Die Chile-Solidaritätsbewegung in der BRD war zerstritten. Das Plebiszit unterstützen oder boykottieren? Boykottieren auch um den Preis, dass Pinochet dann gewinnt? Mitmachen auch um den Preis, dass Pinochet dann gewinnt? Ich selbst plädierte für mitmachen. „Si“ zur Teilnahme, um mit „No“ zu stimmen.
Eindrucksvoll schildert der preisgekrönte halbdokumentarische Spielfilm „NO“ im Jahre 2012 die Vorgänge. Die brutale Arroganz der Macht, die Zweifel der Opposition, den Willen zur Selbstbefreiung, die feindlichen Kampagnen, Angst und Hoffnung des Volks. Eine Bundestagsdelegation konnte vieles beobachten. Wir Parlamentarier sollten ein Auge auf das Plebiszit haben, durch unsere pure Anwesenheit mithelfen, dass die Opposition sich trotz der Einschüchterung durch das Regime halbwegs frei bewegen konnte. Die MdBs der anderen Fraktionen suchten sich als Beobachtungsposten die attraktiven Städte des Südens aus. Wir Grünen, neben mir noch MdB Helmut Lippelt, Bundesvorstand Jürgen Meyer und Referent Ulf Baumgärtner gingen in die Poblaciones und Armensiedlungen um Santiago. Hier wurden viele NO-Stimmen erwartet und viele Schikanen durch das Militär. Auf eine Siedlung rücken Panzer vor, ging das Gerücht. Baumgärtner, ein Veteran der Chile-Solidarität, ließ sich nicht nehmen, sich dort für die Nacht einzuquartieren.
Der Tag des Referendums. Angespannt. Es lag etwas in der Luft. Überall kam es zu Reibereien, aber die Leute konnten abstimmen. Deprimierende Zwischenergebnisse, verkündet von regimetreuen Funktionären. Dann die Wende. Pinochet trommelte seine Generäle zur Krisensitzung. Das konnte nur eins bedeuten – er hatte verloren!
Das Votum des Volkes war eindeutig: 60% stimmte „No“. Die „Vota Si“-Partei der „Pinochetistas“ erlitt eine Niederlage. Ausgelassene Siegesfeiern, das Volk tanzte auf den Straßen. Wir durften mitmachen. Es hatte sich als richtig erwiesen, an dem Plebiszit teilzunehmen. Endlich ein Stück Freiheit! Aber auch noch Unsicherheit. Würden die Militärs das Ergebnis akzeptieren? Würden sie erneut Waffen sprechen lassen? Die Feiernden zusammenkartätschen? – Es blieb friedlich.
Es dauerte noch bis zur freien Wahl im Dezember 1989, die Chile wieder zivilisierte, indem sie den linken Christdemokraten Patricio Aylwin an die Macht brachte. Entscheidend für den Erfolg waren wohl zwei Faktoren gewesen. Die USA verloren angesichts der geopolitischen Veränderungen mit dem Ende des Kalten Krieges die Lust an ihrem Diktator. Und die Opposition hatte ihre Strategie gewechselt. Während die bürgerliche Opposition nach dem Putsch lange stillgehalten hatte, war die Linke im bewaffneten Widerstand verblutet. Auch jetzt noch gab es Gruppen, die davon nicht ablassen wollten, angefeuert durch radikale Unterstützer in Europa. Dabei war klar: einen Machtwechsel würde es nur geben, wenn die Mitte der Gesellschaft, also auch gemäßigte Kräfte, sich gegen den Diktator stellten. Eine demokratische Revolution brauchte eine Mehrheit unter Einschluss konservativer Kräfte. Der Versuch, mit dem Sturz des Diktators zugleich eine sozialistische Revolution zu verbinden, konnte nur auf eine Minderheit zählen und musste scheitern – das hatten die letzten 10 Jahre gezeigt. Revolutionäre Aktionen konnten den Menschen Mut machen, zeigen, dass der Diktator verwundbar war, blieben aber letztlich symbolisch. In einer machtvollen, breiten Opposition würde die radikale Linke absehbar zur Minorität werden, mit geringem politischem Gewicht. Warum opferte sie jetzt immer noch ihr Leben?
In der Solidaritätsbewegung gab es heftige Diskussionen darüber. Viele Aktivisten wollten von ihren alten Träumen nicht lassen, für die bereits so schmerzhafte Opfer gebracht wurden. Meine Haltung war eine andere: man musste versuchen, sie vom Weg des Märtyrertums abzubringen. Seit Jahren kamen immer wieder führende Köpfe der chilenischen Opposition nach Bonn, um mit uns die Strategie zu besprechen und um Unterstützung zu werben. Bei allem Respekt, auf die Solidarität meiner Partei zumindest konnten unzeitgemäße Strategien nicht rechnen. Die anderen umso mehr.
Im Bundestag hatte ich nach der Reise von 1987 eine Kampagne gestartet, die Todesstrafe, die vier inhaftierten chilenischen Linksradikalen drohte, abzuwenden. In Santiago wurde mir im Jahr darauf der Zutritt zum Gefängnis verweigert. Unsere Kampagne aber hatte Norbert Blüm aufgerüttelt, Minister von Kanzler Kohl. Er reiste nach Chile. Die Leute wurden gerettet. Blüm erntete den Ruhm, die Vorgeschichte wurde verschwiegen. Aber die Intervention der deutschen Christdemokraten war auch ein Beweis dafür, dass Pinochet nur zu stürzen war mit konservativen Kräften. Und dafür, dass diese anschließend den Erfolg und die Führungsrolle reklamierten. Obwohl sie selbst einst Pinochets Putsch begrüßt hatten. Hatte nicht CDU-Generalsekretär Heck über die Lage im Fußballstadion von Santiago, in dem die Militärs Tausende von Gegnern eingepfercht hatten und den Sänger Victor Jara ermordeten, gesagt, bei schönem Wetter sei es dort gut auszuhalten. Die Manöver der schwarzen Internationalen waren schäbig; dennoch konnte Pinochet nur mit ihrer Hilfe gestürzt werden. Klug aber wurde die revolutionäre Linke erst, als die Sowjetunion zusammenbrach und mit ihr die letzte Hoffnung auf ein Revolutionsmodell, das sich historisch längst überlebt hatte. Die Parlamentarierversammlung hatte ein wichtiges Zeichen auch für die Mitte der Gesellschaft gesetzt. Die Gemäßigten wurden mutiger. Pinochet wusste, dass die teils heimliche, teils unverhohlene Unterstützung im Westen bröckelte.
Das ist nun alles lange her. Die Diktatoren Lateinamerikas sind von der Macht vertrieben, in manchen Ländern noch geschützt durch die „Impunidad“, die Straflosigkeit. Nationale Einheit ist vielen noch wichtiger als das Aufarbeiten der Verbrechen. Aber die Zeiten ändern sich, manchen holt seine Vergangenheit ein.
Selbst der Führer der Colonia Dignidad, Deutscher, Pinochets Scherge, lange von den Behörden geschützt und geduldet, hat inzwischen seinen Richter gefunden. Auf dem riesigen, unzugänglichen und schwer bewachten Gelände der Colonia in der Nähe Santiagos hatte ein Fleischer aus dem Rheinland eine gruselige, antiquiert deutschtümelnde Sekte aufgebaut. Was auf den ersten Blick nur verschroben aussah, hatte sich Kennern längst als ein Lager entpuppt, in dem systematisch Kinder und junge Männer päderastisch missbraucht und über Gehirnwäsche zur Gefolgschaft gezwungen wurden. Auch gab es hier Folterkeller des chilenischen Geheimdienstes. Auf der Reise 1987 war ich vom Katholischen Büro in Santiago vom Treiben der Colonia informiert worden. Amnesty International hatte bereits eine Broschüre herausgegeben, die von der Colonia-Sekte heftig angefeindet wurde, aber keine politische Resonanz gefunden.
Im Bundestag konfrontierte ich nun die Bundesregierung erstmals offiziell mit den Ungeheuerlichkeiten. Andere Kollegen trieben das Thema später weiter. Zu fragen war nämlich, ob die Kolonie in den Genuss der Bestimmungen des Auswärtigen Amtes über den „Schutz der Deutschen im Ausland“ kam. Oder ob die deutsche Botschaft Anstrengungen unternahm, die Kolonie schließen zu lassen. Doch die Regierung mauerte. Erst als ich ab 1998 in der Position des Staatsministers Druck machte und entsprechend mit den neuen demokratischen Behörden Chiles verhandelte, spitzten sich die Dinge zu. Plötzlich fand sich auch eine Staatsanwaltschaft, die den Sektenführer verhaftete und die Auflösung der Kolonie einleitete.
Auch die Nachbarn in Argentinien hatten eine brutale Militärdiktatur durchzustehen. Viele Oppositionelle haben sie nicht überlebt. Sie wurden gefoltert, abgeschlachtet, aus Hubschraubern tot oder lebendig ins Meer geworfen. Alles im Namen der westlichen Freiheit und Marktwirtschaft. Unter den Opfern war Elisabeth Käsemann, Pastorentocher aus meiner Heimatstadt Gelsenkirchen. Sie hatte am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin studiert, ging nach Argentinien, unterstützte den Widerstand, wurde 1977 gefoltert und ermordet.
Auf einer Reise mit Bundespräsident Roman Herzog konnte ich 1999 erfahren, wie verzweifelt die Angehörigen der Verschwundenen immer noch waren. Gibt es eine deutsche Mitschuld? Hat die deutsche Botschaft einst mit der Diktatur kooperiert? Verschleiert sie heute die damalige Kollaboration? Weiß sie mehr, als sie zugibt? Ein Kontaktmann der Militärs war bei der Botschaft ein- und ausgegangen. Notwendiger Minimalkontakt oder abgekartetes Spiel? Der Besuch des Bundespräsidenten drohte zu scheitern, als diese Fragen plötzlich in den Zeitungen von Buenos Aires auftauchten. Wir trafen die Mütter von der Plaza del Mayo, stellten uns jeder Frage. Es war mein Job, auf die Schnelle mit Bonn die Hintergründe abzuklären. Hat die Botschaft, hat das AA, hat Außenminister Genscher, hat Bundeskanzler Helmut Schmidt damals mit den Militärs einen zu kooperativen Umgang gepflegt? Welche Spielräume hatten sie eigentlich gegenüber einer Diktatur? Wie wurden diese genutzt? Ehemalige Botschaftsangehörige schilderten mir ihre Erfahrungen. So manche Frage gilt es noch zu klären. Wie war das damals mit Waffenexporten aus Deutschland an die Junta? Immerhin konnte der Bundespräsident zum guten Schluss den Angehörigen deutscher und deutschstämmiger Opfer Einsicht in die noch greifbaren Botschaftsakten zusagen.
Gern hätte ich den Anwälten der Angehörigen und der Kampagne gegen die Straflosigkeit geholfen, als sie 1999 den Mord an Käsemann wieder aufrollten und die ehemaligen Mitglieder der Junta verklagten. Die Bundesregierung trat der Klage bei. Doch wichtige Dokumente sind längst im Archiv verschwunden. Als im Jahre 2010 – noch auf Betreiben von Außenminister Joschka Fischer – eine Historikerkommission die unrühmliche Rolle des Auswärtigen Amtes in der Nazizeit aufdeckte und die Karrieren der alten Kameraden danach, kam mir oft in den Sinn, auch die Rolle der deutschen Diplomatie in der Zeit der lateinamerikanischen Militärdiktaturen in den 1970er bis 80er Jahren müsse einmal erforscht werden. Viele Nazis hatten sich nach Süd- und Mittelamerika abgesetzt. Und die Bonner Diplomatie? Hatte sie kollaboriert oder – wie sie beteuerte – versucht, in schweren Zeiten die zivilisatorischen Mindeststandards zu verteidigen? Und die Interessen und Rechte der Deutschen? Welcher Deutschen? Die Interessen der dem Tod durch Flucht und Emigration entkommenen Juden oder die der braunen Schergen, die ihnen auf der Rattenlinie folgten? Bemerkenswert war für mich jedenfalls, welch unterkühlte Halbdistanz unsere Botschaft gegenüber der deutschen Kolonie hielt.
Aus lateinamerikanischen Widerstandkämpfern von einst sind seit den 1990er Jahren Staatschefs, Minister, Spitzenbeamte geworden. Die grünen Freunde aus Chile sind aus dem deutschen Exil längst zurückgekehrt, sind Diplomaten, Gewerkschaftsführer, Geschäftsleute. Der Journalist, der mein Telefon nutzte, wurde Leiter des Lateinamerikaprogramms der Deutschen Welle. Santiago 2001. Meine erste Chile-Reise seit 13 Jahren, nun als Regierungsmitglied. Besuch im Goethe-Institut. Großveranstaltung. Hans-Magnus Enzensberger und drei Dichter aus Lateinamerika wollen aus ihren Werken lesen. Der Saal ist überfüllt, die Leute, meist jung, hocken in Gängen, auf Simsen, in Fensternischen. Mühsam dränge ich mich hinein. Plötzlich tosender Beifall. Die Bühne ist noch leer. „Deine Begrüßung!“ sagt jemand hinter mir. Da standen sie, die alten Freunde! Fast alle waren sie da! Herzliche Umarmung. Sie hatten den Kids im Saal die Geschichten aus dem Widerstand erzählt.
Einer von „damals“ sollte noch eine besondere Mission bekommen: Antonio Skármeta, einst Lilienthals Drehbuchautor, längst ein berühmter Schriftsteller, dessen Roman “Mit brennender Geduld” Kassenschlager in den Kinos wurde (“Il postino”). Im Jahre 2000 wurde er Botschafter seines Landes in Berlin. Er meldete sich zum branchenüblichen Antrittsbesuch bei mir im AA. Statt des obligatorischen Kaffeestündchens verabredeten wir ein Alternativprogramm: Ein Treffen im „Zwiebelfisch“. In einem Buch über sein Exil in Berlin hatte Skármeta eine Geschichte über diese Kneipe am Savignyplatz geschrieben. [ii]
So sitzen wir nun am runden Stammtisch. Dazu die Beamten der Lateinamerikaabteilung des AA, für sie ein eher ungewöhnlicher Abstecher. Jeder weiß die Geste von Präsident Ricardo Lagos zu schätzen, eine solch herausragende Persönlichkeit nach Deutschland zu entsenden. Skármeta ist zum ersten Mal wieder an diesem Ort seiner Geschichte. Als Student war er 1973 nach dem Militärputsch geflohen und mittellos am Bahnhof Zoo angekommen, hatte sich nach einem Studentenlokal erkundigt und war im „Zwiebelfisch“ gelandet. Er hatte nach einer Wohngemeinschaft gefragt, in der er unterkommen könnte. Darob hatte eine hochnotpeinliche Befragung eingesetzt. Warum er geflohen sei, warum er keinen Widerstand leiste? Das Urteil der studentischen Berufsevolutionäre war gnadenlos ausgefallen. Nicht die richtige revolutionäre Gesinnung, Rechtsabweichler, kein Platz in der WG! –
Wir diskutieren die Lateinamerikapolitik. Die Latinos hatten Angst, aus dem Blickfeld der Europäer zu geraten, jetzt, da die großen Umbrüche geschafft waren, und auf Gedeih und Verderb auf den großen Bruder im Norden verwiesen zu sein. Die USA hatten gelernt aus den bösartigen Fehlern der letzten Dekaden. Heute wurden Demokratien gefördert, besonders wenn sie sich einem Freihandel verschrieben, der den Nordamerikanern neue Märkte eröffnete. Die amerikanische Freihandelszone – für die einen Hoffnung auf Entwicklung, für die anderen das Schreckgespenst der völligen Auslieferung an die starke US-Wirtschaft. Umso wichtiger schien uns die Stärkung regionaler Integration in Lateinamerika selbst. Der „Mercosur“ mit Brasilien, Argentinien, Uruguay, Paraguay und dem assoziierten Chile bot die Chance auf eine neue Wachstumsregion, die eigenständiges Gewicht entwickeln konnte. Der Mercosur suchte die strategische Partnerschaft mit der EU, wollte die Fixierung auf die USA durch eine zweite Blickrichtung auflösen können. Und wir Europäer hätten große Chancen, Lateinamerika, in das so viele europäische Generationen ausgewandert waren, enger an uns zu binden.
Doch Ideen sind das eine, die europäische Visa-Politik etwas anderes. Manch ein Besuch wurde abgeblockt, lateinamerikanische Geschäftsleute unter den Generalverdacht der Drogenschieberei gestellt. Auch die europäische Agrarpolitik schert sich wenig um übergeordnete außenpolitische Ideen. Wie oft habe ich auf Konferenzen die Beschwörung der Zusammenarbeit mit Lateinamerika selbst mitformuliert. Aber der europäische Erweiterungsprozess lenkte den Blick nach Osten. Der Interessenausgleich findet eher zwischen West- und Osteuropa statt, die Verteilungsspielräume für Kompromisse mit anderen Wirtschaftsregionen sind beschränkt. Die Enttäuschung der Latinos ist groß. Für viele sind wir nicht beliebige Wirtschaftspartner, wir sind das Mutterland, zu dem sie Bindungen wollen.
Santiago, März 2001. Die Delegationen der EU und der Rio-Gruppe, der lateinamerikanischen Länder, stehen beim Empfang zusammen. Auch die Delegationen der südostasiatischen Wirtschaftsgemeinschaft ASEAN sind dabei, die ebenfalls mit der Rio-Gruppe verabredet sind. Ein wunderbares Dreiecksverhältnis, denn auch wir Europäer treffen alle zwei Jahre auf die Südostasiaten. Wir stehen in der Moneda, dem Amtssitz des Präsidenten, eben dort, wo Präsident Salvador Allende 1973 umkam, als Pinochet den Putsch mit einem Bombenangriff begann. Seine Tochter schildert die Ereignisse.
Zwei Jahre zuvor hatte ich im AA die Idee vom Transatlantischen Dreieck formuliert. Bundespräsident Roman Herzog hatte sie aufgenommen. Auf der gemeinsamen Südamerikareise 1999 verkündete er die strategische Partnerschaft von Europa und Lateinamerika, eingebettet in das Transatlantische Dreieck von Europa, Südamerika und Nordamerika. Jetzt in Santiago wurde die Partnerschaft bekräftigt. Balsam für die Latinos, aber sie erwarteten Konkretes! Eine Reform des europäischen Agrarmarktes, der nicht länger die Kooperation verhindern sollte.
Der Kongress hat sein freies Wochenende. Entspannung ist angesagt. Es bietet sich eine Goodwilltour an. Und so beginnt das Verhängnis, das eine ganz andere, die bizarre, Dimension der Außenpolitik, des interkulturellen Dialogs, der steten Friedensbemühungen entlarvt: Besuch bei deutschen Auswanderergemeinden. In vielen Wellen waren sie nach Chile gekommen. Die Armutsflüchtlinge des 19. Jahrhunderts; Menschen, die vor den Nazis flüchteten; nach dem Krieg geflohene Nazis. Zum Schluss kamen die Honeckers. Unsere Delegation sucht die erste Welle.
…
Die braven Leute hatten seit Generationen eine kleine, aber feine Existenz aufgebaut. In einer wunderschönen Landschaft. Von der Politik bekamen sie wenig mit. Die Diktatur hatte sie kaum berührt. Im Gegenteil, das Kleinbürgertum und der kleine Mittelstand hatten Pinochets Putsch begrüßt. Neben mir saß der örtliche Senator, Parlamentskollege, Mitglied von Pinochets Partei. Kein Unhold, sondern ein netter Kerl, harmlos, bodenständig – und auf groteske Weise deutsch. Pinochet habe Chile gerettet. Und wir Deutschen müssten zusammenhalten. Wir Deutschen? Wann denn seine Familie eingewandert sei und woher sie komme, fragte ich. 150 Jahre war es her, und der Name klang nach böhmischen Dörfern. Ich deutete auf eine Europakarte mit den Grenzen von 1914. „Wo liegt der Ort?“ Er zeigte es mir. Ein böhmisches Dorf, heute in Tschechien. Aber die neueren Entwicklungen in Europa waren hier unten, nahe Kap Hoorn, noch nicht richtig angekommen.
Auch das gehört zur Völkerverständigung. Und gerade Kolonien von Auswanderern, so eigentümlich sie auch scheinen mögen, können Brückenpfeiler bei der Pflege bilateraler Beziehungen sein. Vielleicht sollte man mal dran denken, wenn es um ausländische Kolonien in Deutschland geht. Hier jedenfalls hatten deutsche Wirtschafts- und Armutsflüchtlinge ihr Glück gemacht. …
Eine deutsche Idylle, friedlich, heiter, arglos. In einem Chile, in dem es andere nicht mehr gab, den Sänger Victor Jara zum Beispiel. Ihm, dem Poeten der sozialen Gerechtigkeit, hatten die Militärs nach dem Putsch die Hände gebrochen, damit er nicht mehr Gitarre spielen konnte. Dann musste er sein Leben lassen – damals. Ermordet im Stadion des Endspiels der Fußballweltmeisterschaft von 1962, dort, wo es – wie es die CDU ausdrückte – bei schönem Wetter gut auszuhalten war.
Nachtrag 2011: Die Klagen gegen Mitglieder der argentinischen Junta und ihre Schergen haben Erfolg. Fast 40 Jahre danach werden einige zu lebenslänglicher Gefängnisstrafe verurteilt. In Gelsenkirchen wird eine Bildungsstätte nach Elisabeth Käsemann benannt.
Nachtrag 2: Im Februar 2012 bin ich wieder in Chile. Jetzt privat. Ich erkenne Schauplätze von damals, besuche unseren Botschafter. Wenig erinnert an die Diktatur. In der Moneda wimmeln Touristen. Davor steht ein Denkmal für Allende. Studenten demonstrieren in Massen gegen das Bildungssystem – die Polizei schlägt zu wie bei uns. Demokratische Normalität. Knapp drei Wochen später feiere ich mit wildfremden Menschen meinen 60. Geburtstag auf den chilenischen Klippen von Kap Hoorn.
Nachtrag 3: 40 Jahre nach der Ermordung Victor Jaras erlässt ein chilenischer Richter einen internationalen Haftbefehl gegen den in Florida lebenden Mörder. Das Estadio Chile trägt seit zehn Jahren den Namen des Sängers.
[i] 1975, Drehbuchautor war Antonio Skármeta, der uns gleich noch begegnen wird
[ii] Skármeta, Antonio (1978), in: Napasonada (Nix passiert, 1980)
[iii] siehe vorher gehendes Kapitel