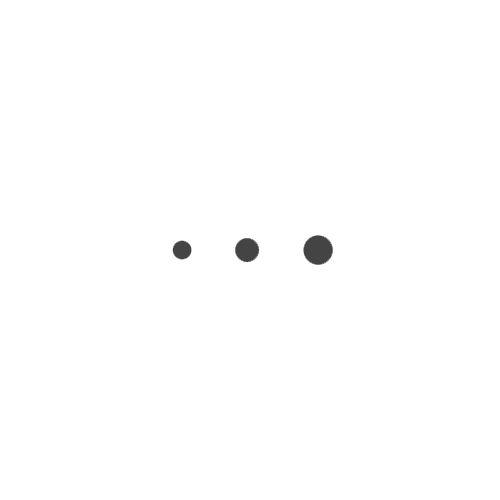(anlässlich einer sogenannten „Friedensdemo“ gegen den Ukraine-Krieg Anfang 2023 schrieb ich diesen Essay über die Ideengeschichte des Pazifismus und die deutschen Friedensbewegungen. Er erschien in der Berliner Zeitung online am 15. März 2023 unter der Überschrift „Die Friedensbewegung sollte nicht fürs Falsche missbraucht werden“ und in der Printausgabe am 20. März 2023 mit ähnlichem Titel. Der Essay wurde mehrfach online „nachgedruckt“.)
„Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg!“ So lautete eine Parole der Friedensbewegungen in BRD und DDR. Eine Konsequenz aus dem deutschen Nationalsozialismus: Holocaust und Angriffskriege, Völkermord und Militarismus waren jeweils zwei untrennbare Seiten derselben braunen Medaille. Die DDR beanspruchte Antifaschismus als offizielle Staatsdoktrin. Im Westen musste er in jahrzehntelangen Kämpfen gegen reaktionäre Kräfte durchgesetzt werden. Die Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen und von Militarismus war für Friedensbewegte untrennbar miteinander verbunden. Sie wurde zum Wesensgehalt des deutschen Nachkriegs-Pazifismus. Bis heute bietet dieser Handlungsanleitungen für viele, die sich für einen ökologischen Humanismus und die Zivilisierung der Außenpolitik einsetzen.
Im Kosovo-Konflikt 1999 allerdings gerieten Pazifismus und Antifaschismus in dramatischen Widerspruch zueinander: wer damals als Antifaschist den drohenden Völkermord verhindern wollte, musste einen Militäreinsatz zumindest tolerieren. Wer als Pazifist Waffengewalt ablehnte, musste einen Völkermord in Kauf nehmen. Billiger war eine politische Entscheidung nicht zu haben. Die Nato-Intervention im Kosovo verstieß gegen die UNO-Charta, weil kein Beschluss des Sicherheitsrates vorlag. Dennoch stimmte die UNO später gegen eine Verurteilung. Denn nur durch die Intervention war die Gefahr des Völkermordes gebannt worden. Der Widerspruch von Legalität und Legitimität deckte eine gravierende Lücke im Völkerrecht auf. Aus den vollendeten Völkermorden in Ruanda und Srebrenica sowie dem drohenden im Kosovo zog die UNO-Vollversammlung die Konsequenz und postulierte die „Responsibility to Protect“. Diese „Schutzverantwortung“ verlangt einzugreifen, notfalls militärisch, wenn ein Staat sein Gewaltmonopol missbraucht, um einen Teil seines Volkes auszulöschen.
Der Glaube, pazifistische Ethik sei im Sinne einer überhistorischen Wahrheit immer und überall bruchlos gültig, erwies sich als fragwürdig. Das zeigt bereits ein Blick auf die Entwicklung dieser Idee. Früheren Pazifismen war eines gemeinsam: die individuelle Weigerung, in einem eskalierten internationalen Konflikt zur Waffe zu greifen, wäre zugleich die Lösung des Problems gewesen. Im Ersten Weltkrieg etwa gab es nicht eindeutig den Aggressor und das Opfer. Geldgierige Industrielle und ein dummdreister Adel auf allen Seiten trieben in ihrer menschenverachtenden Hybris mit schlafwandlerischer Sicherheit ganze Völkerschaften ins Verderben, allen voran die proletarischen Klassen. Verteidigung war kein Thema. „Die Waffen nieder!“, forderte die Pazifistin Bertha von Suttner. Eine Weigerung von Arbeitern, sich für die „hohen Herren“ abschlachten zu lassen, hätte zugleich das Problem gelöst; der Krieg wäre ausgefallen.
Pazifistische Vordenker wie Carl von Ossietzky wurden Ende der 1920er Jahre zu frühen Mahnern und Widerstandskämpfern gegen die Nazis und ihre Angriffsmaschinerie. Sie blieben nicht bei individueller Verweigerung; sie attackierten den aggressiven Nationalismus und wiesen den Weg zur friedlichen Völkerverständigung. Ihr Kampf richtete sich mit friedlichen Mitteln innenpolitisch gegen die eigene aggressive Regierung. Verteidigung war auch hier kein Thema; das Land war von keiner Seite bedroht.
Das ethisch und politisch motivierte Gewaltverbot relativierte sich, als erkennbar wurde, dass die Nazi-Diktatur nur gewaltsam zu beseitigen war. Kein ernsthafter Pazifist wird Elser, Thälmann, Stauffenberg und den Getreuen vom 20. Juli die Verletzung des Tötungsverbotes vorwerfen. Ossietzky und Suttner erlebten den Überfall der Nazis auf Polen und die Sowjetunion nicht mehr. Was hätte ihnen ihre pazifistische Ethik in diesem Moment geboten? „Sag Nein!?“ Ja, sicher, als Aufruf zum Widerstand gegen Nazis und Wehrmacht. Aber auch als Aufruf an die, die sich mit allem, was sie hatten, gegen die Vernichtungskriege der Nazis wehrten? Waren der militärische Durchhaltewille der Roten Armee, die Standhaftigkeit Churchills und Roosevelts D-Day ethisch zu verurteilen wie Hitlers Imperialismus? Trauen wir Ossietzky und Suttner nicht zu, dass sie zwischen Angreifern und Opfern zu unterscheiden gewusst hätten? Hätten sie einen raubmörderischen Überfall und die Notwehr dagegen gleichgesetzt, weil auf beiden Seiten Waffen zum Einsatz kamen und Menschen starben? Sie zu Recht zu verehren und ihnen zugleich eine solche intellektuelle Unschärfe zu unterstellen, wirkt schal.
Mit Trumans Atombombenabwürfen begann zum Ende des Zweiten Weltkriegs das nukleare Zeitalter. Es brachte neue Pazifismen mit sich. In der BRD versuchte die „Ohne mich“-Bewegung in den 1950er Jahren, die Wiederbewaffnung unter Führung alter Nazi-Offiziere zu verhindern. Die „Kampf dem Atomtod“-Bewegung richtete sich gegen eine deutsche nukleare Teilhabe. Auch wenn Ethik eine Rolle gespielt hat, beide waren politische Bewegungen, wendeten sich in ihren „Ostermärschen“ gegen die eigene Regierung und wurden im sich verschärfenden Kalten Krieg bald als 5. Kolonne Moskaus denunziert. Angesichts der Kriege westlicher Staaten von Algerien bis Vietnam und ihrer Unterstützung von Militärdiktaturen stieg Ende der 1960er Jahre in der BRD die Zahl der Kriegsdienstverweigerungen sprunghaft an. Auch wenn sich Kriegsdienstverweigerer bei der damals vorgeschriebenen „staatlichen Gewissensprüfung“ auf eine abstrakte Gesinnungsethik berufen mussten, um anerkannt zu werden (so auch der Autor), richtete sich ihr Ethos eigentlich politisch gegen die westliche Militärpolitik und eine Bundeswehr in der Tradition der Wehrmacht. Der bewaffnete Widerstand von Befreiungsbewegungen in der „Dritten Welt“ wurde toleriert, manchmal aktiv unterstützt.
All diese Bewegungen kulminierten in der BRD in den späten 1970er Jahren in der „Friedensbewegung“, die sich mit unterschiedlichen Stoßrichtungen gegen die Nuklearstrategien der Großmächte USA und UdSSR wendete. Ein Strang hatte allein die „Nachrüstung“ der Nato mit Mittelstreckenraketen im Blick. Nicht ganz zu Unrecht wurde ihm vorgeworfen, objektiv die Interessen Moskaus und Ost-Berlins zu vertreten. Der andere Teil, dem die staatsunabhängige Friedensbewegung in der DDR entsprach, prangerte die atomare Abschreckungsstrategie und Blockkonfrontation als Gesamtsystem an, einschließlich der sowjetischen Raketen. Als Pazifisten verstanden sich alle.
Der Nuklearpazifismus konnte sich zur Massenbewegung verbreitern, weil es bei einem atomaren Schlagabtausch absurd gewesen wäre, zwischen Aggressor und Verteidiger zu unterscheiden. Der „atomare Holocaust“ hätte ohne Rücksicht auf Strategie, Ethik und Interessen alles menschliche Leben ausgelöscht. Gesinnungsethik und politische Verantwortungsethik waren kongruent. Deshalb und nur deshalb konnten sich die Slogans „Frieden schaffen ohne Waffen“ und „Schwerter zu Pflugscharen“ mit ihrer verallgemeinert antimilitärischen Botschaft durchsetzen.
Nach dem Ende der atomaren Blockkonfrontation 1990 spaltete sich die Friedensbewegung auf: Gesinnungsethiker und radikalisierte Antimilitaristen trafen sich in der kompromisslosen Ablehnung alles Militärischen. Weil das Zeitalter zwischenstaatlicher Konflikte überwunden schien und sich das politische Denken auf die kooperative Lösung globaler Probleme richtete, fiel die fehlende Unterscheidung von Angriff und Verteidigung nicht weiter auf. Die Gegenströmung begnügte sich nun mit traditioneller Sicherheitspolitik, gewiss mit „Frieden“ als Politikziel, aber gestützt auf konventionelle Bewaffnung. Man freute sich, zu den Gewinnern des Kalten Krieges zu gehören und den Verlierern „westliche Werte“ beibringen zu können. Antifaschismus entwickelte sich zum Kampf für Menschenrechte. Pazifismus aber galt langsam als altmodische, ja, anrüchige Veranstaltung. Es wuchs die Neigung, ohne jede friedenspolitische Ambition Konflikte in militärischer Logik zu interpretieren.
Dazwischen entwickelte sich der „politische Pazifismus“. Er geht angesichts vergangener Kriegsgräuel von der Vision einer waffenfreien, kooperativen Weltgesellschaft aus. Es kommt ihm darauf an, die Kriegsursachen zu bekämpfen, das Primat des Politischen gegenüber dem Militärischen zu stärken, militärische Funktionen durch zivile zu ersetzen, durch kollektive Sicherheit eine strukturelle Nichtangriffsfähigkeit herzustellen, durch frühzeitige Krisenprävention gewaltsame Eskalationen zu verhindern und friedliche Konfliktlösungen durchzusetzen. Im Falle des Scheiterns aber, bei drohenden Völker- oder Massenmorden, kommt Militär als „Ultima Ratio“ infrage, wenn die „Prima Ratio“, die gewaltvermeidenden Methoden, nachweislich bis zum letzten ausgeschöpft sind. Und er respektiert das in der UNO-Charta verbriefte Recht auf individuelle und kollektive Notwehr und den Aufruf zur Nothilfe.
Die neuen Bedrohungen seit Mitte der 1990er Jahre wie ethnische Säuberungen und der internationale Terrorismus sind weder allein militärisch noch zivil zu bekämpfen. Oft werden Realitäten von radikalen Pazifisten wegretuschiert, um das eigene Weltbild zu retten. Konventionelle Politik hingegen agiert gern mit einer erschreckenden Wurstigkeit. Der politische Pazifismus stellt sich den Realitäten und sucht einen Weg, der am ehesten seinen ethischen Selbstverpflichtungen entspricht. Seine Verantwortungsethik hält auch die Widersprüche aus, die sich aus der Diskrepanz von Hoffnung und Möglichkeit ergeben. Er sucht nach Frieden, weiß aber auch, dass die Zeit für Verhandlungen erst „reif“ ist, wenn die Kriegsgegner sich von einem Friedensschluss mehr versprechen als vom weiteren Kampf. Vorschnelle Rufe nach Verhandlungen machen sich im besten Fall lächerlich; im schlimmsten Fall helfen sie der falschen Seite.
Das trifft auch auf den Krieg gegen die Ukraine zu. Das Moskowitische Regime hat völkerrechtswidrig und ohne legitimen Grund seinen Nachbarn überfallen. Es gibt eindeutig Angreifer und Verteidiger, Täter und Opfer. Der radikale Pazifismus bleibt hilflos angesichts der Gräuel. Um sich nicht einseitig solidarisieren zu müssen, sucht er nach der Schuld des Westens. In der Tat, der Westen hat nach 1990 gravierende, ja, unentschuldbare Fehler im Verhältnis zu Russland begangen, als er die Chance auf eine gesamteuropäische Friedensordnung mutwillig verspielte. Seine Treulosigkeit gegenüber Gorbatschow ist schändlich. Auch die Ukraine hat massive Fehler im Umgang mit der russisch-sprachigen Bevölkerung begangen. Und so manche Bedrohungsanalyse hat vielleicht im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung das Problem erst geschaffen, gegen welches man sich nun wappnet. Nichts, aber auch gar nichts davon rechtfertigt jedoch den russischen Angriff auf das selbständige Völkerrechtssubjekt Ukraine, immerhin im Jahre 1945 eine Mitgründerin der UNO.
Bis zum Überfall hielt der politische Pazifismus bei der Suche nach einem friedlichen Interessenausgleich auch die russische Sicht der Dinge hoch. Der Überfall zerstört alle diplomatischen Hoffnungen. Umso klarer muss gerade bei Pazifisten die Konsequenz sein: Es gibt Täter und Opfer. Eine Gleichsetzung oder gar Umkehr verletzt jede pazifistische Ethik. Eine Protestbewegung, deren Forderung nach Waffenstillstand und Verhandlungen faktisch die Kapitulation der angegriffenen Ukraine bedeutet, ist keine „Friedensbewegung“. Suttner und Ossietzky haben es nicht verdient, von ihr missbraucht zu werden.