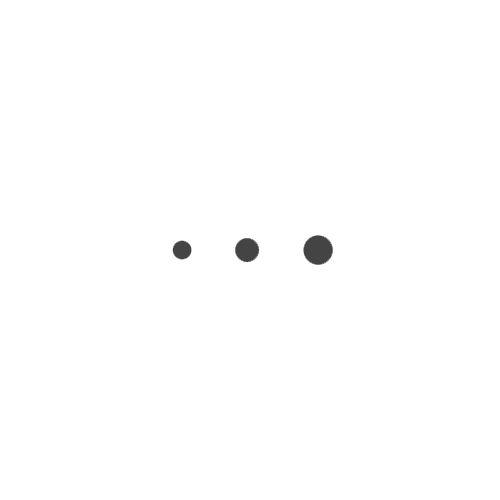(Für eine französische Zeitschrift schrieb ich einen Artikel über Begriff und Praxis des Politischen Pazifismus. Der Titel: Pacifisme politique: l‘Allemagne comme puissance civile, in: Allemagne d’aujourd’hui, No 202, Oktober-Dezember 2012, auf deutsch bisher unveröffentlicht)
Rot-Grün an der Macht
Kosovo 1999: Rot-Grün hat Deutschland in den Krieg geführt – zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg. Dies war zweifellos eine historische Zäsur, für manchen Zeitgenossen gar eine Ungeheuerlichkeit – im Guten oder im Bösen. Als hätte eine andere – eine liberal-konservative Regierung – dies nicht getan. Die Absurdität des Umkehrschlusses zeigt, dass es eher die Zeitläufe waren als die Weltanschauungen, die diesen Schritt erzwangen. Aber das Wie, die politischen Begründungen, die Einbettung der Intervention in die politische Ideenwelt dürften sich links und rechts unterschieden haben. Bis heute driften die Bewertungen auseinander.
Während Konservative eine angebliche „Normalisierung“ und „das gewachsene außenpolitische Gewicht“ Deutschlands feierten, riefen radikale Linke und Pazifisten „Kriegstreiberei“ und „Verrat“. Letztlich ging es um die neue Rolle des vereinigten Deutschlands in der Welt. Traditionalisten wollten zurück zum starken Nationalstaat samt realpolitischer Strategie und militärischer Machtprojektion und fühlten sich durch die rot-grüne Politik bestätigt. Linke Pazifisten beharrten auf dem Internationalismus der Friedensbewegung samt Antimilitarismus und dialogischer Konfliktlösung und waren von Rot-Grün enttäuscht.
Als Rot-Grün 1998 die konservative Regierung von Helmut Kohl nach 16 Jahren ablöste, sollte, so der SPD-Slogan, nicht alles anders werden, aber vieles besser – auch in den internationalen Beziehungen. Doch dann kam vieles anders und nicht alles besser: Kosovo, Afghanistan, Irak – wer sich in der Friedensbewegung engagiert und große Hoffnungen in Rot-Grün investiert hatte, konnte mit den realen Entwicklungen nicht glücklich sein. Die Frustration suchte sich Werturteile: Hatte die Regierung, angeführt vom sozialdemokratischen Bundeskanzler Gerhard Schröder und dem grünen Außenminister und Vize-Kanzler Joschka Fischer, mutwillig verraten, wofür sie gewählt war? Oder hatte die Geschichte Wendungen genommen, die weder vorauszuahnen noch zu verhindern waren und letztlich keine andere Wahl ließen? War die Intervention akteurs- oder situationsbedingt, war sie vermeidbar oder zwangsläufig? Bei allen Antagonismen war Konservativen und Linken eines gemeinsam – bezogen auf die rot-grüne Außenpolitik irrten sie.
Skeptiker hatten eine rot-grüne Koalition zuvor für unmöglich gehalten, weil mit den Grünen kein Staat zu machen sei. Ihre außenpolitischen Ideen seien antiwestlich, romantisch, wirr. Doch Günther Verheugen, außenpolitischer Sprecher der SPD und später EU-Kommissar, und ich, ehemaliger Parteivorsitzender der Grünen und verantwortlich für Friedenspolitik, waren uns bei der Formulierung des außenpolitischen Teils des Koalitionsvertrages schnell einig: Deutschland solle Zivilmacht sein, auf der Basis eines erweiterten Sicherheitsbegriffs zivile Krisenprävention zur Maxime erheben und mit einer multilateralen und integrativen Ausrichtung versuchen, regionale Konflikte durch einen fairen Interessenausgleich friedlich beizulegen. An der Außenpolitik würde Rot-Grün nicht scheitern, zumindest nicht auf dem Papier. Zugleich aber spürten wir, dass sehr schnell die Geschichte über uns hinweg rollen könnte. Wie ein Damoklesschwert hing ein drohender Kosovo-Krieg über uns. Jugoslawien zerfiel seit Beginn des Jahrzehnts in blutigen Kriegen. Die Lage in Bosnien-Herzegowina war auch nach dem Vertrag von Dayton noch nicht wirklich unter Kontrolle, und im Kosovo braute sich etwas zusammen.
Jugoslawien: Nationalismus und Sezession
Als der Kosovokrieg dann Ende März 1999 ausbrach, war man sich in der politischen Diskussion einig, dass Diplomatie und Peacekeeping der internationalen Gemeinschaft auf der ganzen Linie versagt hatten. Dabei hatte es frühzeitige Warnungen gegeben. Doch gerade dem Kalten Krieg entronnen und mit der deutschen Einheit und ihrer europäischen Einbindung beschäftigt, war die Welt einfach nicht auf einen Eskalationsprozess wie im zerfallenden Jugoslawien vorbereitet. Die UNO verfügte nicht über hinreichende Mittel, noch schlagkräftige Mandate. Die Europäischen Staaten projizierten, während sie einerseits um eine Vertiefung der Integration rangen, andererseits eigene nationale Interessen auf den Balkan und förderten so den Zerfall. Als wären sich Völkerrechtler nicht einig: Selbstbestimmungsrecht der Völker heißt nicht Staatenbildungsrecht. Würde jede Ethnie, jeder Stamm seinen eigenen Staat haben wollen, die Erde wäre ein unbewohnbarer Ort.
Es hätte Lösungsansätze gegeben: Jugoslawien war Ende der 1980er Jahre das am höchsten verschuldete Land Europas. Besonders teuer war sein enormes Militärpotential, das es – durchaus im Interesse des Westens – unabhängig von Moskau machte. Nachdem der Westen keine Notwendigkeit mehr sah, durch finanzielle Stabilisierung das Abdriften des blockfreien Staates in den Warschauer Pakt zu verhindern, überließ man das Land sich selbst. Kurz: Der Westen ließ Jugoslawien schlicht fallen. Debatten im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, von den Grünen initiiert, über einen Schuldenerlass, führten nicht zu den nötigen Konsequenzen durch die liberal-konservative Regierung von Helmut Kohl. Was folgte, wurde teurer.
Die ökonomische Perspektivlosigkeit begünstigte den Nationalismus eines Slobodan Milošević, der den auf mehr Autonomie bedachten Teilrepubliken mit Unnachgiebigkeit begegnete – anfangs noch aus gesamtstaatlichem Interesse. Doch einige Teilrepubliken waren der Vorherrschaft Belgrads überdrüssig. Die industrialisierten Slowenien und Kroatien zahlten die meisten Steuern, hatten aber in den Belgrader Staatsapparaten wenig zu sagen. Als sie begannen, angesichts der internen Krise mit der EU zu liebäugeln, erfuhr der Nationalismus des Präsidenten die Metamorphose zur großserbischen Wahnidee. Irrational waren seine Herrschsucht und die Mythen, die bedient wurden. Rational aber war die Einschätzung, dass die westlich gelegenen, katholisch geprägten, historisch mit Venedig, Österreich und Italien verbundenen Gebiete Anschluss an Europa finden könnten, während das orthodoxe slawische Serbien mit dem muslimischen Dritte-Welt-Land Kosovo als Klotz am Bein zurückbliebe.
Als Slowenen und Kroaten sich abspalten wollten, was nach der jugoslawischen Verfassung möglich war, musste die internationale Gemeinschaft, zuvörderst die EU, Position beziehen. Doch die Mitgliedstaaten hatten keinen „Gemeinsamen Standpunkt“, sondern jeder seinen eigenen und einseitigen Blick – ähnlich wie im Jahre 1914. Es kam zum Streit zwischen Deutschland und Frankreich, den die Deutschen – selbst noch im nationalen Überschwang der Wiedervereinigung – mit der nationalstaatlichen Konzeption gewannen: Slowenien und Kroatien wurden als eigenständige Nationalstaaten anerkannt, ohne dass man, wie die Franzosen nicht zu Unrecht gemahnt hatten, zugleich eine Lösung für das verbleibende Jugoslawien gehabt hätte.
Als der serbische Nationalismus nun ethnische Positionen immer stärker zu betonen begann, hätte die Verschiebung der innerjugoslawischen Kräfteverhältnisse in Europa die Alarmglocken schrillen lassen müssen. So aber setzte sich für die jugoslawischen Integrationsprobleme das nationalstaatliche Lösungsmuster durch. Jede Teilrepublik wollte ihren Nationalstaat, jede Minderheit in den Teilrepubliken opponierte dagegen und forderte Sezession auf immer niedrigeren Ebenen. Bosnien wurde zum Schlachtfeld, ethnische Säuberungen, Massenmorde und systematische Vergewaltigungen erinnerten an die finstersten Momente der europäischen Geschichte und riefen nach dem Versagen der UNO-Politik die NATO auf den Plan. Spätestens als dieser Krieg in Dayton am 21. November 1995 durch die Bildung eines unabhängigen Staates, bestehend aus den zwei Entitäten der bosnisch-kroatischen Allianz und der Republika Srpska, offiziell beendet wurde, stand das Thema Kosovo auf der Tagesordnung. Denn nun sah sich im verkleinerten Rest-Jugoslawien die kosovo-albanische Minderheit mit einer erdrückenden und intoleranten serbischen Übermacht konfrontiert.
„Early warning“ im Sinne der Krisenprävention hatte es also gegeben, „early action“ auch, aber eben keine Gemeinsamkeit der Europäer. Wenn später – bei Konservativen wie bei „Menschenrechts-Interventionisten“ – der Vorwurf erhoben wurde, Europa habe viel zu spät militärisch eingegriffen, so verkennt dieser Einwand das eigentliche Problem, nämlich das Fehlen eines gemeinsamen politischen Willens, der die Eskalation des Konflikts möglicherweise hätte verhindern können.
Rot-Grün im Entscheidungsdilemma
Bis zu diesem Punkt war der Konflikt gediehen, als die rot-grüne Bundesregierung im Oktober 1998 die Amtsgeschäfte übernahm. Sie hatte den Konflikt weder verursacht noch verhindern können, sondern geerbt und musste mit den Konsequenzen umgehen. Viel lieber hätte sie sich um die drängenden innenpolitischen Fragen gekümmert und mit einem Ökologischen New Deal das Land zukunftsfähig gemacht. Nun aber stand die Frage von Krieg und Frieden auf der Tagesordnung, und Rot-Grün traf die strategische und konzeptionelle Entscheidung, im Sinne des vereinbarten Zivilmacht-Postulats jederzeit zu versuchen, zu deeskalieren und nicht-militärische Lösungen zu finden, ohne sich aus der Verantwortung zu stehlen.
Konnte die neue rot-grüne Mehrheit die Vorentscheidung der Regierung Helmut Kohls noch beeinflussen, die den Amerikanern militärische Unterstützung zugesagt hatte? Wollte sie das überhaupt angesichts der völkermörderischen Politik der Serben im Kosovo? Vertreter pazifistischer Zurückhaltung und humanitärer Intervention stritten seit Jahren in beiden Koalitionsparteien, besonders heftig bei den Grünen, um Gesinnung und Verantwortung. Diese Grundsatzfrage war unter Rot-Grün noch nicht geklärt. Eine abstrakte Diskussion hätte die neue Koalition zerrissen, kaum dass sie gebildet war. Und das nach 16 Jahren Helmut Kohl, als sich selbst liberal-konservative Kräfte in Schröders Neue Mitte eingereiht hatten, um den Reformstau endlich aufzulösen. Rot-Grün konnte die Hoffnungen der neuen gesellschaftlichen Mehrheit, für die es jahrelang gekämpft hatte, nicht dadurch zerstören, dass angesichts einer eskalierenden außenpolitischen Situation alle wieder auseinanderstoben. Zumal der Bevölkerung die Dramatik gar nicht bewusst war. Rot-Grün: vor der Verantwortung davongelaufen, vor der Geschichte versagt. Interessant, wie einig der neue Außenminister Joschka Fischer und ich als Staatsminister uns plötzlich in dieser Frage waren, die wir uns ein Jahrzehnt als Antipoden in der Partei gegenübergestanden und manch überhitzten Streit geliefert hatten, er als Leitfigur der gemäßigten Realo-Strömung, ich als Leitfigur des linken Flügels.
Nach dem Massaker von Srebrenica hatten sich unsere Positionen angenähert. Das Wahlprogramm 1998 enthielt eine Formel, mit der alle einigermaßen gut leben konnten. Das sicherheitspolitische Primat lag bei der zivilen Krisenprävention. Nur wenn diese ernsthaft versucht worden und dennoch gescheitert war, sollte ein Nachdenken über begrenzte militärische Konsequenzen möglich sein. Das war eine klare Abgrenzung gegen die konservative Rede von der „ultima ratio“ militärischen Eingreifens. Denn diese Formel verdeckte, dass über die „ersten“ Mittel in der traditionellen Sicherheitspolitik nicht nachgedacht und das „letzte“ somit zum einzigen wurde.
Legalität versus Legitimität
Ein amerikanischer Wille und die deutsche Zustimmung jedoch bildeten noch keine hinreichende völkerrechtliche Basis für eine Intervention. Gemessen am Kern des Völkerrechtes, der UN-Charta, war ein NATO-Angriff gegen Serbien nicht legal. Er verstieß gegen die Formel von der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten, und es gab für den Angriff nicht den notwendigen Beschluss des UN-Sicherheitsrates.
Dennoch konnte man den Befürwortern einer solchen Aktion nicht einfach den Bruch des Völkerrechts vorwerfen. Denn dieses ist in Wirklichkeit kein Völker-, sondern ein Staatenrecht. Es regelt die Beziehungen der Staaten untereinander, nicht deren innere Angelegenheiten. Was aber sollte geschehen, wenn ein Staat sein Gewaltmonopol missbrauchte, um eine Volksgruppe zu schikanieren, zu vertreiben, zu töten? Obwohl die UN-Charta eine Reaktion auf die Mordmaschine der Nazis darstellt, ist genau dieser Fall nicht hinreichend geregelt. In Bosnien war die ethnisch-religiöse Minderheit der Muslime drangsaliert worden. Im Kosovo nun zeichnete sich ab, dass der Despot in Belgrad die kosovo-albanische Mehrheit aus dem Lande treiben wollte. Es drohte ein Völkermord. Völkermord meint nicht etwa, dass alle Individuen eines Volkes physisch vernichtet werden. Der Tatbestand besteht bereits dann, wenn mithilfe von Mord und Totschlag ein Volk vertrieben und seine kulturelle Identität zerstört wird. Genau das aber bahnte sich an.
Die internationale Gemeinschaft stand also vor der Entscheidung, entweder den Wortlaut der UN-Charta zu achten und Vertreibung und Völkermord mehr oder weniger tatenlos zuzuschauen. Oder aber den drohenden Völkermord auch mit Waffengewalt zu unterbinden und dabei gegen das geschriebene Recht zu verstoßen. Die Intervention im Kosovo sei völkerrechtlich eine Ausnahme, betonte die Bundesregierung. Das war keine dahergeredete Floskel, sondern eine gezielt gesetzte Formel. Sie verwies auf die Quellen des Völkerrechtes. Anders als beim innerstaatlichen Recht gibt es hier keinen gewählten Gesetzgeber. Letztlich ist Völkerrecht Vertragsrecht, das auf Vereinbarungen zwischen den Staaten basiert. Verträge kann man indes erweitern, beispielsweise weil sie der Realität nicht mehr entsprechen oder weil einzelne Akteure gezielt dagegen verstoßen, um einen neuen Rechtstandard zu erreichen.
Eine weitere Quelle des Völkerrechts ist das Gewohnheitsrecht. Wenn eine Staatenpraxis sich dadurch etabliert, dass ihr von anderen Staaten nicht widersprochen wird, so gilt sie als rechtens. Die Ausnahmeklausel der Bundesregierung bedeutete nun expressis verbis, dass aus dem Angriff auf Jugoslawien kein Völkergewohnheitsrecht erwachsen dürfe. Politisch erklärte Rot-Grün damit den existierenden Rechtszustand für unbefriedigend, weil er für die aktuelle Situation keine Lösung bereithielt. Zugleich aber mahnte sie, nicht einfach zur Selbsthilfe zu greifen, sondern das internationale Recht als allgemein verbindliche Grundlage weiter zu entwickeln.
Dass die NATO den UN-Sicherheitsrat bewusst nicht angerufen hat, lag im drohenden Veto Russlands und Chinas. Doch beiden ging es nicht um globale Verantwortung und universelle Werte, sondern um eigene nationale Interessen (Tschetschenien, Tibet). Weil die NATO aber auch nach einer Ablehnung durch den Sicherheitsrat agiert hätte, verzichtete sie auf dessen Anrufung. Auf diese Weise wurde immerhin seine völlige Desavouierung vermieden. Für Grüne war dies ein Grenzfall, der sich nur durch die genozidalen Entwicklungen im Kosovo rechtfertigen ließ.
Ein Antrag in der UN-Vollversammlung, dieses Manöver zu verurteilen, scheiterte. Die Staatenmehrheit schien ein Gefühl für die Unzulänglichkeit des Völkerrechts zu haben und weigerte sich, der NATO angesichts des drohenden Völkermordes in den Rücken zu fallen. Im Übrigen bekräftigten diverse UN-Resolutionen in den folgenden Jahren die zentrale Denkfigur der „Verantwortung zu schützen“. Nicht zuletzt aufgrund der Kosovo-Erfahrung wuchs der Wille, sich in innere Angelegenheiten einzumischen, wenn ein Staat sein Gewaltmonopol in tödlicher Absicht missbraucht.
Nicht nur das „Recht zum Krieg“ war umstritten, sondern auch das „Recht im Krieg“. Denn die NATO-Luftangriffe trafen zahlreiche zivile Opfer. Die NATO tat sie mit dem lapidaren Hinweis auf kriegsübliche Kollateralschäden ab – ein unangemessener Umgang. Die USA informierten die deutsche Seite nicht über die genaue Luftkriegsstrategie und Zieldefinition, was besonders fatal wurde, als die militärischen Ziele ausgingen. Hier spiegelte sich das klassische deutsche Sicherheitsdilemma, auf die Hilfe des atlantischen Partners angewiesen zu sein, aber keinen echten Einfluss auf dessen Strategie zu haben.
Das deutsche Bundesverfassungsgericht wies eine Strafanzeige der Partei Linke/PDS gegen die Bundesregierung wegen der Teilnahme an einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zurück. Das Ergebnis ist zu begrüßen, die Begründung jedoch scheint wenig einleuchtend. Die deutsche Teilnahme wurde nicht als eigenständiger Willensakt, sondern als Akt der „gegenseitigen kollektiven Sicherheit“ interpretiert, der durch die Verfassung und internationale Normen gedeckt sei. Ob die Aktion des Kollektivs NATO aber legal war, wurde nicht überprüft. Zudem ist ein „System gegenseitiger kollektiver Sicherheit“ eine Sicherheitsordnung, die potenzielle Feindstaaten unter einem Dach vereinigt, um durch die Verschränkung von Kommandostrukturen und Waffenarsenalen eine strukturelle Nichtangriffsfähigkeit herzustellen. Die NATO jedoch ist ein Militärbündnis, das sich nicht gegeneinander, sondern nach außen verteidigen will, im Falle des Kosovo aber zum Angriff blies. Es wäre plausibler gewesen, wenn das Gericht auf den beschriebenen Widerspruch im Völkerrecht hingewiesen hätte. Das wäre kein Freispruch erster Klasse geworden, hätte aber den historischen Umständen Rechnung getragen und die Debatte um die Weiterentwicklung des Völkerrechtes befruchtet.
Die Legitimität des NATO-Einsatzes kann angesichts der systematischen Menschenrechtsverletzungen im Bosnienkrieg, besonders des Massenmordes in Srebrenica, schwerlich in Zweifel gezogen werden.
Allerdings unterliefen einige gravierende kommunikative Fehler. Etwa als der Verteidigungsminister die Truppenbewegungen Belgrads mit dem Begriff „Plan Hufeisen“ versah – ein Name, der nicht verifiziert werden konnte. An diesen Lapsus hefteten sich die Kritiker, die nun behaupteten, die Vorwürfe gegen Serbien seien völlig aus der Luft gegriffen. Selbst beim Massaker von Racak, das letztlich den Krieg auslöste, wurde die serbische Urheberschaft bezweifelt. Spätere forensische Untersuchungen der OSZE, die den Beweis brachten, wurden ignoriert.
Auch Fischers Auschwitz-Rhetorik war wenig hilfreich, weil der misslungene Vergleich die Legitimation des Eingreifens eher verminderte –im Vergleich mit der industrialisierten Tötungsmaschinerie der Nazis schien im Kosovo alles weit weniger schlimm. Und manch ein Angesprochener reagierte trotzig, weil er sich nicht durch eine solche rhetorische Keule zur Linientreue zwingen lassen wollte.
Doch unabhängig von derartigen Kommunikationsfehlern gab es die Massaker an Kosovo-Albanern und die riesigen Flüchtlingsströme Richtung Mazedonien tatsächlich. Sie waren auch nicht eine Folge der späteren Bombardierungen, wie die Linke/PDS behauptete, sondern deren Ursache. In dieser Lage hatte die Internationale Gemeinschaft vielleicht nicht das Recht einzugreifen, doch sie hatte geradezu die ethische Verpflichtung. Dass sie dabei an die Grenzen des Völkerrechts stieß, ja dessen Wortlaut sogar verletzen musste, gehört zur Tragik der Geschichte.
Gescheiterte Friedensdiplomatie
Die NATO hatte bereits im Herbst 1998 mit militärischen Maßnahmen für den Fall gedroht, dass Milošević Mord und Vertreibung nicht stoppte. Deutschland trat der NATO-Strategie bei auf der Grundlage des Bundestagsbeschlusses vom Oktober 1998, während des sogenannten Interregnums. Die Regierung Kohl hatte die Bundestagswahl gerade verloren, der neue Bundestag aber war noch nicht konstituiert, Schröder noch nicht zum Kanzler ernannt. Formell galten die alten, abgewählten Mehrheiten, mit denen dieser Beschluss gefällt wurde. Dennoch waren auch ein Großteil der SPD-Abgeordneten und etwa die Hälfte der Grünen für den Waffeneinsatz. [1] Ich selbst hielt als einziger Abgeordneter im Bundestag die Gegenrede und verwies dabei auf die mangelnde Krisenprävention und auf die Völkerrechtswidrigkeit. Alle hofften, dass der Waffenstillstand, kontrolliert von der Kosovo-Verifikations-Mission der OSZE, hielte. Doch dann platzte in ein Spitzentreffen des Auswärtigen Amtes im Januar 1999 die Nachricht vom Massaker in Racak und vom Verlangen der USA, sofort militärisch zuzuschlagen. Die NATO signalisierte Alarmstufe „rot“. Die neue rot-grüne Spitze im deutschen Außenministerium aber wollte einen Krieg unbedingt vermeiden und ergriff die Initiative für eine vielleicht letzte Friedenskonferenz. Zwei Tage lang telefonierte der Außenminister mit allen westlichen Kollegen; dann war es geschafft.
Aus diplomatischen Gründen fand die Konferenz unter französischer Schirmherrschaft in Rambouillet statt. Auch die Amerikaner konnten gewonnen werden. Sie verlangten allerdings einen Preis: Wenn sie ihre militärischen Pläne zurückstellten, müsste sich Deutschland verpflichten, im Fall des Scheiterns von Verhandlungen an der Intervention teilzunehmen. Das Junktim wurde eingegangen, auch weil die meisten rot-grünen Akteure einem Völkermord keinesfalls zuschauen wollten. Auf der Konferenz drängte man alle Beteiligten zum Einlenken. Dabei diktierte die NATO allerdings das Ziel: Beendigung der Vertreibung, Waffenstillstand, friedliche Koexistenz. Verhandelbar war der Modus.
Kritiker, auch grüne, behaupten, Rambouillet sei von den Vereinigten Staaten auf ein Scheitern angelegt gewesen. In der Tradition der Imperialismuskritik suchten sie nach der bösen Absicht der USA. Auch Wortführer des konservativen Antiamerikanismus stellten diese Frage. Welches Interesse trieb die Supermacht? Was hatte sie überhaupt in Europa zu suchen? Links- und Rechtsnationalisten mussten eine Teufelei wittern, weil sie das Ursprungsproblem nicht wahrzunehmen bereit waren. Wer den totalitären Anspruch Milosevics ignorierte und den Konfliktparteien auf dem Balkan gleichermaßen Schuld zusprach, konnte auch die Notwendigkeit eines Engreifens von außen nicht erkennen. Er hatte auch kein Gespür für das Versagen der Europäer. Aus diesem Blickwinkel musste die amerikanische Intervention als aggressiver Akt gedeutet werden. In Wirklichkeit war die Schwäche der Europäer die Stärke der Amerikaner. Diese konnten sich als Garanten universeller Werte darstellen. Zugleich bot sich ihnen die Chance, den erstarkenden Europäern die eigene Unverzichtbarkeit vor Augen zu führen.
Verschwörungstheoretiker führen den „Annex B“ des Vertragsentwurfes als Beweis für das falsche Spiel der USA an. Dieser Anhang habe von Milošević verlangt, das gesamte Territorium durch NATO-Truppen besetzen zu lassen – eine unannehmbare Forderung. In Wirklichkeit regelte der Anhang die Stationierung einer internationalen Kosovo-Schutztruppe nach einem Friedenschluss. Er machte sogar im Sinne des Kapitels VI der UN-Charta die Einigung der Konfliktparteien untereinander zur Voraussetzung. Die Klauseln des Annex B, die der entsprechenden UN-Regelung für Bosnien abgeschaut waren, blieben zudem verhandelbar.
Die USA übten massiven Druck auf die von der rassistisch-mafiotischen UÇK geführten Kosovaren aus, einem Vertrag beizutreten, der sie entwaffnete und ihnen das erstrebte Ziel der staatlichen Unabhängigkeit versagte. Ganz im Interesse Belgrads sollte die territoriale Integrität des serbisch-montenegrinischen Staatsverbandes inklusive Kosovo garantiert werden. Auf der anderen Seite sollten die Serben ihre Politik des Völkermordes stoppen. Doch Belgrad entsandte keine Delegation mit Verhandlungsvollmacht, Milošević sabotierte den Friedensplan von Anfang an.
Er wollte keinen Frieden. Er konnte seine Macht nur noch als Kriegsherr in einer unübersichtlichen Situation, von Moskau gestützt, behaupten. Und in der Tat war mit dem Scheitern von Rambouillet die letzte Chance auf eine friedliche Lösung dahin. Wer jetzt ein militärisches Eingreifen ablehnte, der nahm faktisch den Völkermord in Kauf. Eine unzumutbare Entscheidungssituation für grüne Pazifisten, aber Realität. Einfacher und billiger war das Regieren nicht zu haben. Und die Flucht vor dieser Verantwortung hätte bedeutet, historisch zu versagen. Opposition aus Angst vor der Verantwortung? Es wäre das Ende der Grünen gewesen.
Kriegs- und Friedensgeschrei – Rot-Grün vor dem Aus?
Als mit zunehmender Dauer des Krieges die Luftangriffe ihr politisches Ziel verfehlten, aber immer mehr Zivilisten trafen, wurden auch Befürworter nervös. Immer lauter wurde die Forderung nach einem Ende der Bombardierungen. Doch was waren die Alternativen? Sollte man einen sofortigen Frieden mit Serbien aushandeln? Das hätte den Sieg Miloševićs bedeutet. Wollte man durch die Entsendung von Bodentruppen einen Sieg erzwingen? Das hätte zu einer unabsehbaren Eskalation geführt. Joschka Fischer und ich besprachen in der Osterwoche eine Exit-Strategie: bei Aufrechterhaltung des militärischen Drucks sollten Verhandlungen über eine gleichzeitige Beendigung von Vertreibung und Luftkrieg geführt werden. Für diesen Plan, den auch Kanzler Schröder akzeptierte, wurde die EU gewonnen, die NATO stimmte zu, und letztlich übernahm Kofi Annan das Programm als UN-Friedensplan. Mitentscheidend war die von Bundesaußenminister Fischer bewirkte Reintegration Russlands in den Lösungsprozess.
Dieser Plan musste allerdings nicht nur gegen die Befürworter eines Einmarsches von Bodentruppen durchgesetzt werden, sondern auch gegen die radikalpazifistische Opposition in den eigenen Reihen. „Nie wieder Auschwitz, nie wieder Krieg!“ So hatten die pazifistischen Bekenntnisse seit 5 Jahrzehnten gelautet. Pazifisten hatten wenig reflektiert, wie sehr sie historisch bedingt waren. Auschwitz und Krieg, beides hatte denselben Ursprung, die militaristische, nationalistische, rassistische Brutalität der Nazis. Antifaschismus hieß gleichzeitiges Eintreten gegen eine Militarisierung der Politik und gegen Völkermord. Der Frage, wie der D-Day zu bewerten sei, die Landung der Alliierten in der Normandie, um Europa militärisch vom Hitler-Faschismus zu befreien, wurde nicht ernsthaft reflektiert. Der pseudo-philosophische Spruch, es gebe keine ‚gerechten Kriege’, tötete als Killerphrase Debatten ab, kaum dass sie aufkeimten. Dabei hatten die Philosophen, die diese Erkenntnis formulierten, klassische Angriffskriege vor Augen, die „Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“, in der Staatenwelt nach dem Westfälischen Frieden von 1648 gang und gäbe. [2] Aus der eigenen, individuellen Weigerung, zur Waffe zu greifen, dem verfassungsmäßigen Recht auf Kriegsdienstverweigerung, wurde bei den postmodernen Pazifisten die politische Weigerung, zwischen ungerechtem Angriff und berechtigter Gegenwehr zu unterscheiden. Die völkerrechtliche Unterscheidung in das „Recht zum Krieg“ und das „Recht im Krieg“ wurde gänzlich übersehen. Die nötige Differenzierung wurde durch den Pauschalbegriff ‚Krieg’ verhindert und zugleich moralisch verurteilt. So wurde die Erkenntnis vermieden, dass Angriffe, Vertreibung, Völkermord manchmal nur durch den Einsatz von Waffen zu beenden sind.
Bei einem Sonderparteitag der Grünen in Bielefeld forderten die Radikalpazifisten die sofortige Beendigung der Kriegsbeteiligung – ein Schrei der Empörung, ohne Kalkulation der Folgen. Denn dieser „Sofortismus“ hätte im Falle seines Erfolges fatale Konsequenzen gehabt: nicht der Krieg wäre zu Ende gewesen, sondern die rot-grüne Koalition. Fischer wäre zurückgetreten, die Koalition geplatzt. Damit wäre der Hauptmotor des Friedensplanes ausgefallen und das rot-grüne Reformprojekt als Ganzes erledigt gewesen. Zum Glück gewann ein Antrag die knappe Mehrheit, der die Kritik aufnahm, aber der Bundesregierung das Vertrauen für die Verfolgung des Friedensplanes aussprach. Auch wenn die Presse danach behauptete, Kriegsbefürworter hätten die Kriegsgegner geschlagen – zur Abstimmung standen zwei Anträge, die den Krieg beenden wollten. Gewonnen hat der realistische gegen den emotionalen. Das war die Paradoxie von Bielefeld.
Friedenskonsolidierung
Aus den Fehlern, die die EU bei der Krisenprävention gemacht hatte, versuchte sie in der Phase der Friedenskonsolidierung zu lernen. Im Zentrum stand der – von der rot-grünen Bundesregierung angeregte und gegen Widerstände durchgesetzte – Stabilitätspakt für Südosteuropa, der allen Nachfolgestaaten Jugoslawiens eine EU-Perspektive bot. Wenn auch heute die Lage noch nicht befriedigt, liegt dies weniger an der EU als am Hass und Misstrauen. Nationalisten besitzen noch ein starkes Gewicht. Die Zerfallsprodukte Jugoslawiens befinden sich in der Hochphase der Nationalstaatenbildung, über die das übrige Europa hinweg ist. Die EU kann deshalb nichts Besseres tun, als den neuen Staaten den Weg zur europäischen Integration zu weisen.
So stellt sich nun abschließend die Frage: Hat das rot-grün regierte Deutschland im Kosovokonflikt als Zivilmacht gehandelt? Ja! Rot-Grün hat weder den Pazifismus verraten noch den Nationalstaat rekonstruiert. Die Bundesregierung hat in jeder Phase versucht, möglichst viel vom eigenen Anspruch der Zivilisierung der Außenpolitik umzusetzen. Sie hat versucht, in einer historischen Ausnahmesituation verantwortlich zu handeln. Es wurden Entscheidungen erzwungen, welche die Akteure aus eigenem Antrieb nie angestrebt hätten. Die Alternativen waren schlecht. Die Beteiligung am Militärschlag war rechtlich bedenklich, im ethischen Sinne jedoch, nach dem Scheitern aller zivilen Bemühungen, legitim, wenn nicht sogar zwingend. Rot-Grün hat durch die Initiative zum Kongress von Rambouillet, zum Friedensplan, zur Reintegration Russlands und zum Stabilitätspakt jederzeit zu deeskalieren versucht und gedrängt, der Krise mit friedlichen Mitteln zu begegnen.
Kampf dem Terror und NEIN zum Irakkrieg
Als zwei Jahre später, nach den Terroranschlägen des 11.September 2001, die Grünen der Beteiligung an der Afghanistan-Intervention zustimmten, war die Grundsatzfrage militärischer Beteiligung weitgehend geklärt. Nur ein kleiner Rest von Radikalpazifisten drohte mit Ablehnung. Als Bundeskanzler Schröder die Abstimmung deshalb mit der Vertrauensfrage verband, wich das reine Gewissen, das die Radikalpazifisten als Grund ihrer Weigerung anführten, dem schlichten taktischen Machtkalkül. Sie losten aus, wer von ihnen mit Ja stimmen musste, um die Regierung zu retten. Dabei war die Operation Enduring Freedom als Verteidigungsakt gegen erneute Terrorangriffe nicht nur legitim, sondern, gestützt auf das Selbstverteidigungsrecht in der UNO-Charta, auch völkerrechtlich legal. Zudem galt die Beistandsverpflichtung des NATO-Vertrages. Ob die OEF wie auch der ISAF-Stabilisierungseinsatz, der von Rot-Grün später einstimmig beschlossen wurde, effektiv waren, ob sie nicht irgendwann die Legitimität einbüßten- das sind berechtigte Fragen.
Manche behaupten, nur das Ja zu den Kosovo- und Afghanistaneinsätzen habe dem rot-grün regierten Deutschland die Freiheit verschafft, 2003 rigoros gegen den Angriff auf den Irak einzutreten. Diese Deutung verkennt, dass sich tief in den politischen Denkmustern von Rot-Grün längst ein Selbstverständnis zur neuen Rolle Deutschlands in der Welt eingeprägt hatte. Deutschland wollte Zivilmacht sein. Eine Zivilmacht schließt nach ernsthaft versuchter, aber misslungener ziviler Krisenprävention begrenzte Militäreinsätze nicht aus, aber sie lehnt illegale, illegitime und absehbar ineffektive Angriffskriege wie den auf den Irak konsequent ab. Auch dann, wenn alte Freunde, denen gegenüber man historisch zu Dank verpflichtet ist, ihn vom Zaun brechen. Freundschaft und Dankbarkeit verpflichteten laut Rot-Grün nicht zur Vasallentreue bei einem absehbar verhängnisvollen Schritt.
Krisenprävention als „prima ratio“
Der Kosovokrieg verlangte von den nun an die Macht gelangten Friedensbewegten einen Crash-Kurs in Realismus. Während die Schröder-SPD ohnehin zum Pragmatismus neigte, wurden die Grünen zerrissen. Ein Teil flüchtete in einen Radikalpazifismus. Ein anderer Teil transformierte seinen Antimilitarismus zu einer Art politischem Pazifismus, der sich seiner historischen Bedingtheit bewusst war und systematisch versuchte, militärische Mechanismen durch zivile zu ersetzen, auch wenn er – das war die Kosovo-Erfahrung – Militäreinsätze im Extremfall als „ultima ratio“ nicht ausschließen konnte.
Doch parallel arbeitete Rot-Grün an der „prima ratio“, am Aufbau einer Infrastruktur zur zivilen Krisenprävention und -bearbeitung. Nur wenn genügend Personal da sei für Missionen von UNO, OSZE oder EU – so die Konsequenz aus dem Scheitern der OSZE bei der Überwachung des Waffenstillstandes Ende 1998 -, könnten handlungsmächtige Mandate erteilt werden, die die Lücke zwischen klassischer Diplomatie und dem Militär füllten. Als Leuchtturmprojekt dieser neuen Interpretation von Sicherheitspolitik konnte 2002 das „Zentrum für internationale Friedenseinsätze“ (ZIF) in Berlin eingeweiht werden. Tausende Fachkräfte wurden mittlerweile ausgebildet für Wahlbeobachtung, das Monitoring der Menschenrechtslage, für Versöhnungs- und Mediationsarbeit, für den Aufbau von Verwaltung und Justiz und in Einsätze entsandt. Viele Länder haben heute ähnliche Einrichtungen. Krisenprävention und zivile Konfliktbearbeitung als strategische Elemente einer Zivilmacht sind längst als konkurrierende Idee neben den klassischen, militärgestützten Realismus der Nationalstaaten getreten.
Die Instrumentalisierung außenpolitischer Themen für innenpolitische, gar innerparteiliche Zwecke gilt manchem Akteur als geschickte Politik. Sie blamiert sich aber spätestens dann, wenn man in der Regierungsverantwortung steht. Letztlich mussten Grüne, Linke und Pazifisten lernen, dass sie in der real existierenden Staatenwelt mit hunderten Akteuren konfrontiert sind, die eine andere Weltsicht haben. Das erfordert internationale Diskurs- und Handlungsfähigkeit. Nicht unbedingt die Aufgabe der eigenen Haltung. Leider gibt es dafür heute Anzeichen. Der ambitionierte politische Pazifismus, der den paradigmatischen Anspruch der Zivilisierung energetisch besetzt, scheint bei den Grünen wieder zwischen dem radikalpazifistischen Dogmatismus und der opportunistischen Beliebigkeit der Pragmatiker zerrieben zu werden. Ohne treibende Kraft aber, die bewusst ein Ziel verfolgt, wird alles vom Mainstream aufgesogen.
Aber auch der deutsche Mainstream hat gelernt. Militarismus findet sich fast nirgendwo in Deutschland. Eher ein Widerwille, überhaupt außenpolitische Themen zu reflektieren. Große ideologische Debatten über die Rolle des Zivilen und des Militärischen finden kaum noch statt. Spiegelt sich hier eine eher fatale Rückwendung zur deutschen Innerlichkeit? Oder hat der Mainstream wichtige Motive der Friedensbewegung in sich aufgenommen und zur Leitidee deutscher Außen- und Sicherheitspolitik erhoben? Für die schrumpfende Community der Friedens- und Sicherheitspolitiker aber darf vielleicht endlich einmal wieder das große Wort „Dialektik“ benutzt werden. Traditionelle Sicherheits- und avantgardistische Friedenspolitik konvergierten zum Zivilmacht-Konzept, das auch eine innergesellschaftliche Versöhnungsfunktion zu erfüllen verspricht.
[1] Gerhard Schröder schreibt in seinen Memoiren, dass er (mit Billigung von Joschka Fischer und Oskar Lafontaine) Präsident Clinton längst zugesagt hatte, dass Deutschland im Kriegsfall mitziehen würde – während den Bundestagsfraktionen lange vorgegaukelt wurde, es handle sich um eine offene Entscheidungssituation; vgl. Gerhard Schröder, Entscheidungen, Hamburg 2006, S. 110.
[2] Kant, Immanuel (1795), Zum ewigen Frieden