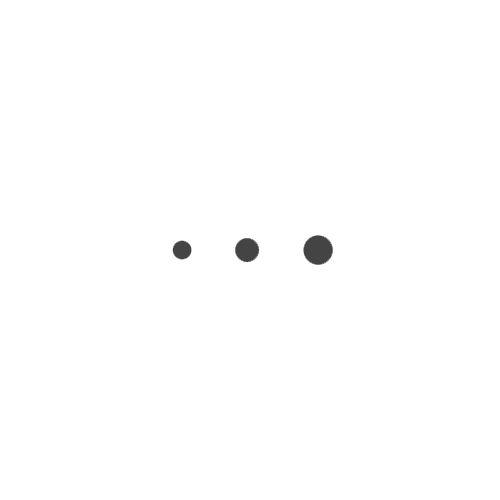(Interview von Wiebke Rigterink zum Thema ihrer Masterarbeit „Die außenpolitische Elite Deutschlands – Am Beispiel der Partei „Bündnis 90/ Die Grünen“ von 1998 bis 2005, geführt am 18. Juni 2012, in der fertigen Arbeit oft zitiert)
Wiebke Rigterink: Wie standen Sie zwischen 1998 und 2005 zur NATO?
Ludger Volmer: Die Grünen haben in den 1990er Jahren die Formel „OSZE-First“ favorisiert, die auch von vielen Staaten befürwortet wurde. Es ging um die Idee, die ehemaligen Feindmächte des Warschauer Paktes und der NATO zusammenzufassen in einem System kollektiver Sicherheit, das von Vancouver bis Wladiwostok reichte und die ehemaligen Feindblöcke umfasste. Diese Idee wurde Mitte der 1990er Jahre über die beginnenden Balkan-Kriege fragil; denn schon während des Bosnien-Krieges hatte die NATO sich eine neue Geltung verschafft. Das war die Situation 1998, als wir in die Regierung kamen.
Gleichzeitig hatte sich die NATO nach Osten erweitert. Wir fanden das nicht unbedingt wünschenswert, weil wir befürchteten, dass neue Bruchlinien zwischen dem erweiterten Westen und dem neuen Osten entstehen könnten. Aber dennoch, 1998 haben wir gesagt: „Pacta sunt servanda“; die NATO existiert und Deutschland ist und bleibt ein Teil davon. Auch die NATO-Osterweiterung ist beschlossen, und eine rot-grüne Regierung wird an dieser Vertragslage nichts ändern können und wollen.
Also die NATO war akzeptiert. Es gab sogar aktive Befürworter der NATO: mindestens ein Drittel war aus sicherheitspolitischen Gründen immer schon für die NATO. Diese Leute waren zwar gegen die atomare Strategie, nicht aber gegen konventionelle Verteidigung. Der bekannteste Vertreter dieser Auffassung ist Joschka Fischer.
Und dann gab es andere Strömungen, zu denen ich mich rechnete. Ich habe mich bezeichnet – und das tue ich bis heute – als politischen Pazifisten: das heißt, ich bin kein Radikalpazifist, der gesinnungspazifistisch ablehnt – in welcher Situation auch immer – zu Waffen zu greifen, sondern ich habe immer plädiert für das absolute Primat des Zivilen, für eine Intensivierung von Krisenpräventionen und ziviler Konfliktbearbeitungen. Und erst nach deren nachweislichen Scheitern wäre ich bereit gewesen, auch Militäraktionen, begrenzt und legitimiert durch den UNO-Sicherheitsrat, mitzutragen.
Ende der 1990er Jahre stellte sich die NATO-Frage aber noch ganz anders: In ihr drückte sich das Verhältnis zwischen Europa und den USA aus. Die NATO musste stärker zu einem transatlantischen Bindeglied werden, um die USA in den europäischen Diskurs einzubinden.
Wiebke Rigterink: Wie bewerteten Sie damals die Möglichkeiten der Vereinten Nationen und ihrer Regionalorganisationen (bspw. OSZE) in der Krisenprävention?
Ludger Volmer: Unabhängig davon, wie skeptisch wir die realen Möglichkeiten beurteilt haben, haben wir eine sehr intensive Politik betrieben, um die UNO und ihre Regionalorganisationen zu stärken, auch ihre Fähigkeiten zum Peace-Keeping und zur Post-Conflict-Peace-Building-Strategie. Wir waren skeptisch gegenüber allen friedensschaffenden Maßnahmen, die Militäreinsätze bzw. Kampfeinsätze beinhalteten. Wir waren absolut dafür, die Regionalorganisationen auszubauen und die UNO als die entscheidende Instanz zur Regulierung von globalen Konflikten zu stärken.
Wiebke Rigterink: Wie haben Sie damals die Beteiligung der Bundeswehr am NATO-Einsatz im Kosovo ohne UN-Mandat beurteilt?
Ludger Volmer: Im Bundestag habe ich bei der entscheidenden Debatte die einzige Gegenrede gehalten und zwar mit dem Argument, dass noch nicht alle zivilen Mittel ausgereizt seien. Dennoch kam es dann zum Krieg – zum militärischen Eingreifen der NATO. Mit dem Massaker von Racak zu Beginn des Jahres 1999 wollten die US-Amerikaner sofort Militäraktionen ergreifen und wollten auch, dass Deutschland sich daran beteiligt. In dem Moment haben wir die Idee aufgeworfen – und daran war ich nicht ganz unbeteiligt–, mit einer großen Friedenskonferenz die gesamte Balkan-Krise noch zu entschärfen. Das führte zur Konferenz von Rambouillet. Erst als Rambouillet scheiterte, was meiner Beobachtung nach einzig und allein an Milosevic lag, gab es keine Argumente mehr, den Befürwortern einer Militäraktion in den Arm zu fallen, weil die Vertreibung und der drohende Völkermord im Kosovo ja weitergingen. Man musste in dem Moment nicht einmal aktiv dafür sein. Es wurden automatisch Prozesse ausgelöst, die vorher schon entschieden waren – an dieser Militärintervention ging nun kein Weg vorbei.
Dann war die Frage vielmehr, worauf die Intervention hinauslaufen sollte, wozu sie führen sollte und wie man sie wieder beendet. Ich war der erste, der die Frage nach der Strategie der NATO öffentlich aufgeworfen hat, was für ein Regierungsmitglied schon eine ziemlich kritische Sache ist, da ich damit die gesamte Intervention in Frage gestellt und dazu beigetragen habe, dass nun darüber diskutiert wurde. Aus dieser Diskussion heraus haben Joschka Fischer und ich uns zusammengesetzt und geschaut, welche Exit-Strategien wir entwickeln könnten. Aus diesem Gespräch entstand das, was dann kurze Zeit später „Fischer-Plan“ hieß. Dieser wurde von der UNO übernommen und lief dann unter dem Namen „Kofi-Annan-Plan“.
Wiebke Rigterink: Wie standen Sie damals allgemein zu Einsätzen der Bundeswehr im Ausland?
Ludger Volmer: Damals war völlig klar: Bundeswehreinsätze sind nicht mehr prinzipiell zu vermeiden. Die gab es mit dem Kosovo und es war absehbar, dass es weitere geben würde. Da stellte sich die Frage, wie man sie eingrenzt und wie man es schafft, neben diesen die Mechanismen der zivilen Krisenprävention zu stärken und zu behaupten. Möglichst viele militärische Elemente durch zivile zu substituieren, das war mein Ziel, das war der politische Pazifismus. Da ging es nicht um Gesinnung, sondern es ging darum, wirklich Funktionsäquivalente zum Militärischen praktisch durchzusetzen. Das haben aber viele nicht begriffen.
Es kann Situationen geben, in denen militärische Interventionen unvermeidlich sind, und das war im Fall Kosovo so und spätere Fälle waren dann ähnlich gelagert. Aber der politische Pazifismus richtet trotzdem primär den Blick auf die zivilen Methoden. Im Kosovo waren, nach dem Scheitern von Rambouillet, tatsächlich alle zivilen Mittel ausgereizt, um den Völkermord zu verhindern, und so stand die deutsche Politik vor einem Wertekonflikt. Bis dahin hatte man gesagt: wir wollen keine Militärintervention und keinen Völkermord – nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz. Im Falle Kosovo war klar, eine dieser beiden Positionen muss man aufgeben. Wenn man der Meinung ist, kein Militär, dann nimmt man den Völkermord in Kauf. Wenn man sagt, der Völkermord muss verhindert werden, ging es nach dem Scheitern von Rambouillet nur noch militärisch.
Es gab eine Reihe von Leuten – auch bei den Grünen – die sich vor dieser Frage gedrückt haben und erst in dem Moment wieder laut wurden, als die NATO mit ihrem Bombardements sichtlich die Falschen traf, als die ersten zivilen Opfer zu beklagen waren. Dann konnten sie sich wieder in die oppositionelle Pose werfen und sagen: „wir sind dagegen“, aber der eigentlichen Entscheidungssituation haben sie sich nicht gestellt.
Wiebke Rigterink: Gab es bei „Bündnis 90/ Die Grünen“ zwischen 1998 und 2005 zwei ideologische Lager?
Ludger Volmer: Zur Zeit der Gründung der Grünen gab es mehr Gruppen als nur zwei Lager. In den 1980er Jahren haben sich diese Gruppen dann zu zwei harten Lagern entwickelt. Ich habe mich immer zu den gemäßigten Linken gezählt und als Leitfigur des linken Flügels insbesondere in den 1990er Jahren eine erfolgreiche integrative Politik gefahren. Als ich als Staatsminister ins Auswärtige Amt wechselte, gab es links in der Partei keinen Nachfolger, der diese Integrationskraft aufbrachte. Deshalb waren wir nach der Wahl 1998 regierungsfähig. Aber dann wurden bis 2005 die Zentrifugalkräfte wieder stärker. Ich habe leichte Zweifel, dass die Grünen, wie sie sich heute im Bundestag darstellen, regierungsfähig wären – in der Frage von Militäreinsätzen gibt es keinen Grundkonsens.
Zum Beispiel Kosovo: Auf dem Sonderparteitag der Grünen zum Kosovo-Krieg 1999 in Bielefeld hatte sich die Parteitagsregie darauf geeinigt, zwei Schlussreden zu machen – im Grunde als Duell. Ströbele und ich sollten die halten. Anders als die Presse behauptete, standen da aber nicht Kriegsbefürworter und Kriegsgegner gegeneinander. Ich war auch Kriegsgegner. Vielmehr standen zwei Ausstiegsoptionen nebeneinander: die radikalere hat Ströbele vertreten. Er wollte sofort aussteigen. Diese Option hätte aber nur dazu geführt, dass die rot-grüne Regierung zu Ende gewesen wäre, nicht aber der Kosovo-Krieg. Meine Position war die, einen Antrag des Bundesvorstandes zu unterstützen, der vorsah, dass die Partei die Politik der Regierung und des Außenministers unterstützen sollte, also den Friedensplan, weil das der einzig realistische Ausweg war. Zum Glück hat meine Position gewonnen.
Später kam der Irak-Krieg: da waren wir alle einmütig gegen, und damit wurde die Spaltung, die im Fall „Operation Enduring Freedom“ (Kampf gegen den Terror/Afghanistan-Einsatz) die Fraktion belastete, übertüncht. Der zweite Afghanistan-Einsatz (ISAF) wurde fast einstimmig angenommen.
Wiebke Rigterink: Wie haben Sie damals das deutsch-US-amerikanische Verhältnis beurteilt?
Ludger Volmer: Zunächst war das Verhältnis freundschaftlich, nämlich zwischen Schröder und Clinton. Auch während der schwierigen Situation im Kosovo. Dann kühlte es sich ab. Nicht wegen Schröder, sondern wegen George W. Bush. Schröder hat nach 9/11 ausdrücklich – sogar mit einem umstrittenen Adjektiv – die Solidarität mit der amerikanischen Regierung ausgedrückt. An den Afghanistan-Missionen haben wir teilgenommen. Die Differenz begann erst und ausschließlich über den Irak-Krieg. Der Grundkonflikt war der, dass die US-Amerikaner einen völkerrechtswidrigen, völlig unsinnigen und kontraproduktiven Krieg vom Zaun gebrochen haben und uns Deutsche in die Pflicht nehmen wollten. Da haben wir zum ersten Mal in der Geschichte gesagt: „Nein, das machen wir nicht mit“. Das war der Grundkonflikt. Es war richtig, den Amerikanern zu sagen: Wir sind euch dankbar für vieles, dass ihr für uns getan habt. Wir würden gerne mit euch an einem Strang ziehen und globale Fragen klären, aber unsere Dankbarkeit verpflichtet uns nicht zu einer Vasallen-Treue bei verbrecherischen Aktionen.
Wiebke Rigterink: Wie standen Sie damals zu einem EU-Beitritt der Türkei?
Ludger Volmer: Ich habe damals als Staatsminister gesagt, dass wir die Türkei in die EU unter bestimmten Bedingungen aufnehmen können. Diese These habe ich auch vor dem Europäischen Parlament vertreten, als Deutschland im ersten Halbjahr 1999 die EU-Ratspräsidentschaft hatte. Die Diskussion gab es natürlich schon vorher, aber dies war das erste Mal, dass ein Regierungsmitglied dazu Position bezogen hat. Ich war damals, wie heute, der Meinung: die Frage, soll die Türkei Mitglied in der EU werden, ist falsch gestellt. Die Frage ist eine ganz andere, nämlich: wie muss die Türkei sich verändern, damit sie Mitglied werden kann?
Das impliziert, dass es keinen prinzipiellen Ausschluss gibt. Prinzipiell steht die Tür offen, denn die EU ist keine Religions- sondern eine Wertegemeinschaft. Ob die Türkei dieser Wertegemeinschaft angehören kann, muss sie selber entscheiden. Sie muss sich in vielen Bereichen intensiv verändern. Wenn sie das tut, dann steht einer Mitgliedschaft nichts im Wege. Die Frage ist, wie realistisch man das einschätzt. Vor einigen Jahren gab es eine wirkliche Dynamik in der Türkei – eine proeuropäische Dynamik –, die zu massiven Reformen geführt hat. Kein Land hat sich so stark verändert wie die Türkei. Aber es hat trotzdem nicht gereicht. Außerdem kamen in Berlin die Konservativen wieder an die Macht und haben der Türkei die kalte Schulter gezeigt. So verschwand dort die EU-Euphorie, und die Türken sagten sich: wenn die uns nicht wollen, dann müssen wir auch die Reformen nicht weiter voran treiben. Wenn wir dazu gezwungen sind, uns stärker an den Orient anzulehnen, dann können wir auch alte orientalische Muster wieder pflegen. Damit ist der ganze Prozess zum Erliegen gekommen.