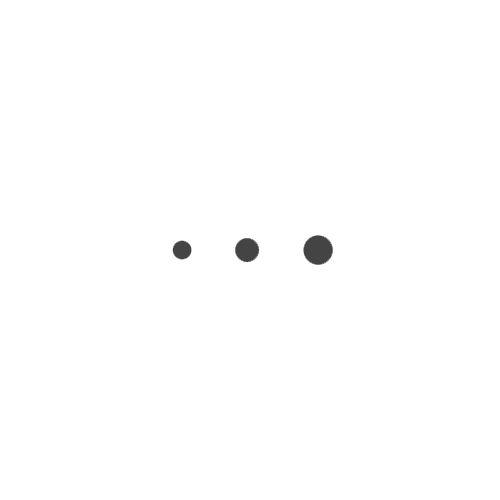(Anlässlich des aufflammenden Konflikts zwischen Israel und der Hamas im Mai 2021 erlaube ich mir, das entsprechende Kapitel aus meinem Buch „Kriegsgeschrei“ hier separat einzustellen. Es heißt: „Doppelte Standards und das zweite Gesicht“. Das erste Manuskript dazu entstand bereits 2008, die Zwischenüberschriften sind neu eingefügt.)
Israel und Palästina – ein No go für deutsche Politik?
„Sie sind Präsident, kein Politiker. Davon verstehen Sie nichts. Halten Sie sich da raus!“ Barsch herrschte Benjamin Netanjahu, Israels Regierungschef, Roman Herzog, den deutschen Bundespräsidenten, an. Herzog blieb gleichmütig, ließ die Tirade scheinbar ungerührt an sich abprallen. Als verstünde er kein Englisch. Der Dolmetscher übersetzte etwas weich gezeichnet. Was hatte Herzog verbrochen, dass er sich eine solche Suada einhandelte? Das Existenzrecht Israels in Frage gestellt? Die besondere deutsche Verantwortung für diesen Staat? Die Hauptstadt Jerusalem? Nichts von alledem. Er hatte schlicht gefragt, wie der Israeli die Lebenssituation der Palästinenser im Westjordanland einschätze. Das reichte, um sein Gegenüber explodieren zu lassen. Was dort drüben geschah, war nicht für die Augen der Weltöffentlichkeit geeignet, nicht für prominente Beobachter, erst recht nicht für deutsche. Kein Thema!
Als Vertreter der Bundesregierung begleitete ich im November 1998 den Bundespräsidenten in den Nahen Osten. Auch Ignaz Bubis, Michel Friedmann, Hans Küng und Friede Springer gehörten der Delegation an. Zu Beginn der Reise hatten wir – wie bei jedem offiziellen Besuch in Israel Pflicht und Wunsch – in Yad Vashem der Opfer des Holocaust gedacht. Ein schlichter und ergreifender Akt. Wir hatten Jitzhak Rabins Grab besucht, seine Witwe getroffen, um zu zeigen, dass unsere Sympathie den Friedensfreunden im Nahen Osten gehörte.
Und nun – Netanjahu! Es war etwas verstörend, was dieser Herr uns auftischte. Anhand der Wandkarte wurden uns die israelischen Gebietsansprüche und Sicherheitsinteressen erklärt. Für die Palästinenser blieb da nicht viel Raum. Ein Flickenteppich zerrissener Gebiete markierte ihr Gelände, dazwischen israelische Siedlungen und militärisch kontrollierte Straßen. Ein Volk oben auf Hügeln, ein Volk unten in Tälern. Die Deutschen, nachdrücklich an ihre historische Verantwortung erinnert, sollten das Szenario kommentarlos hinnehmen.
Von Israel fuhren wir in die Palästinensergebiete, nach Jericho. Mit dem eigenen Bus, nicht mit israelischen Staatskarossen. Die Israelis demonstrierten ihre Macht, hielten den angemeldeten Konvoi an der Grenze protokollwidrig, fast schikanös lange auf. Herzog wich den Problemen nicht aus. Er wollte ein eigenes Bild der Lage gewinnen. Geduldig hörten wir uns auf der Westbank die verzweifelten Klagen deutscher Frauen an, die mit Palästinensern verheiratet waren. Eindrucksvoll schilderten sie das Elend des Alltags, die ständige Angst, die Perspektivlosigkeit. Die Verzweiflung war echt und erschütternd. Bei allem Verständnis – im Gespräch mit Arafat ließen wir dem Palästinenserchef dennoch nichts durchgehen. Dieser hatte mal wieder die Gespräche mit Israel abgebrochen, wir machten Druck, bis er einzulenken versprach.
In der Reisegruppe entspann sich eine lebhafte Diskussion darüber, ob Israel seine Sicherheitsinteressen wirklich optimal vertrat. Wie lange konnte ein solcher Hardliner-Kurs gut gehen? War der israelischen Regierung die Meinung der Weltöffentlichkeit wirklich gleichgültig? Durfte oder musste man die israelische Politik als Apartheid bezeichnen? Verlangte die deutsche Verantwortung wirklich, alles kritiklos zu schlucken? Oder hieß ernsthafte Wahrnehmung von Verantwortung, deutlich zu widersprechen, wenn die Dinge vorhersehbar eine fatale Entwicklung nahmen? Ignaz Bubis, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, der Liberale, der Humanist, der Freund, war tief erschüttert. Er sagte mir Dinge über Israel, das Land, in dem er nicht lange darauf seine ewige Ruhe fand, die ein nichtjüdischer Deutscher öffentlich nie sagen dürfte.[i]
„Dass (Deutschland) nach den schrecklichen Verbrechen des Nationalsozialismus für den Bestand und das Schicksal des Staates Israel Mitverantwortung trägt, ist selbstverständlich, doch diese wird durch die zeitweilige Intransigenz Israels nicht gerade erleichtert. Auf der anderen Seite tut Deutschland gut daran, sich seine traditionelle Freundschaft zu den arabischen Völkern und erst recht deren traditionelle Deutschlandfreundlichkeit so weit wie möglich zu erhalten.“ Roman Herzogs Memoiren mögen von manchem Rezensenten als etwas selbstgefällig kritisiert worden sein – einen solchen Satz hat man von Johannes Rau, Gerhard Schröder oder Joschka Fischer damals nicht gehört.[ii]
Kurz vor der Reise konnte ich bei einer kleinen, aber feinen Aktion verhindern helfen, dass von deutscher Seite ein Schatten auf den Besuch in Israel fiel. Die Lufthansa rief mich an. An Bord einer ihrer Maschinen nach Tel Aviv saß der rechtsgerichtete CDU-Politiker Heinrich Lummer samt einigen Kumpanen. Ein Geheimdienst hatte die Fluggesellschaft gewarnt, die Truppe wolle im Heiligen Land Rabatz machen. Der Einstieg war zwar nicht zu verhindern gewesen, aber die Herrschaften benahmen sich an Bord laut und ungebührlich. Nach Rücksprache mit mir landete die Maschine kurzerhand in Istanbul. Die schwarz-braunen Kreuzzügler wurden an die Luft gesetzt. Bei den türkischen Behörden konnte ich für die LH-Maschine einen schnellen Slot erreichen, so dass sie noch am selben Tag nach Tel Aviv kam.
Die Hoffnung: „Land gegen Frieden“ statt Besetzung und Terror
Seit dem 11. September 2001 hat das Thema Nahost eine neue Dimension erhalten. Kampf dem transnationalen Terrorismus – das müsste vor allem heißen, die tiefe Verstimmung zwischen der arabischen und der westlichen Welt zu beseitigen. Wann immer man sich dem Thema nähert, drängt sich schnell ein zentraler Konflikt in den Vordergrund: der Nahostkonflikt, genauer, der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Hier liegt das Kernproblem, der Focus-Konflikt, andere Konflikte leiten sich davon ab, werden dadurch überformt, nähren sich daran, verbergen sich dahinter. Der Konflikt ist sicherlich nicht Ursache für den Terror, für den es keine Legitimation geben kann. Aber er ist Anlass, Vorwand, Motiv für Generationen arabischer Jugendlicher, sich vom Westen abzuwenden, den Frust über die Modernisierungskrise der eigenen Gesellschaft zu projizieren, sich zu radikalisieren. Hier findet sich der Nährboden für Terrorgruppen. Dagegen hilft letztlich kein Militär, kein Imponiergehabe. Hier ist der Dialog der Kulturen angesagt, ein Dialog, der keine abstrakte Veranstaltung für Akademiker bleiben darf, kein Sinnieren über Religionen. Hier muss mit gegenseitigem Respekt und Einfühlungsvermögen über Handfestes geredet werden, über gegenseitige Sicherheit, über Lebenschancen und Entwicklungsrichtungen, über die Beteiligung der Menschen an der politischen Gestaltung ihrer jeweiligen Gesellschaft.
Joschka Fischer und ich waren uns in dieser Analyse einig. Nach langen, manchmal erbitterten Auseinandersetzungen war sie Konsens in der grünen Partei geworden.[iii] Einig waren wir uns auch darin, dass der Nahostkonflikt nur auf der Basis der Zweistaatlichkeit zu lösen sei. Die Palästinenser brauchten ihren eigenen, lebensfähigen, unabhängigen Staat, Israel die Anerkennung des Existenzrechtes und Sicherheitsgarantien. So lauteten auch die Kernpunkte der „Road Map“ der internationalen Gemeinschaft. „Land gegen Frieden“ – diese Formel, wie auch immer variiert, bietet letztlich den Schlüssel zur Lösung des Konfliktes. Alles andere ist Zeitverschwendung.
Unter der Oberfläche einer pragmatischen Zusammenarbeit aber gab es eine nicht ganz unerhebliche Differenz zwischen Joschka und mir. Fischer rollte die gesamte Nahost-Frage aus der Sicht der israelischen Sicherheitspolitik auf. Er sprach sich für eine kooperative Sicherheitspolitik aus, die an Verständigung interessiert war, nicht an einem militärischen Sieg. Nur wenn man sich prinzipiell auf die Seite Israels stelle, habe man Einfluss auf dessen Politik und könnte die Friedenskräfte stärken, meinte Fischer. Das liege objektiv im Interesse auch der Palästinenser. Man kann über diesen Diskurs-Ansatz streiten. Ich blieb skeptisch. Letztlich war er erfolglos. Jeder andere Ansatz allerdings auch.
Holocaust, Völkermorde, schreiendes Unrecht
In der deutschen Öffentlichkeit kam Fischer damit gut an. Zufällig war er in der Nähe, als ein grauenhaftes Selbstmordattentat vor einer Diskothek in Tel Aviv zahlreiche Jugendliche zerriss. Er griff öffentlich ein, redete der israelischen Regierung einen Gegenschlag aus und ging mit Arafat ins Gericht. Das war gut. Dennoch stellten sich Fragen: Warum reagierte er nicht bei Übergriffen der israelischen Armee in den Palästinensergebieten? Und war Arafat eigentlich die richtige Adresse?
Fischer gab in Deutschland das Bild eines in Israel und Palästina gleichermaßen geachteten Vermittlers ab. Die Wirklichkeit hinter den Kulissen sah etwas anders aus. In Israel wurde er gefeiert bis zur Verleihung der Ehrendoktorwürde. Bei den Palästinensern jedoch galt er als verlorener Freund, ja, als Verräter, weil er nicht über genuine Palästinenserrechte redete, sondern ihnen Rechte von Israels Gnaden zubilligte. Abseits des Protokolls wurde mir das in aller Deutlichkeit mitgeteilt.
Die Palästinenser waren maßlos enttäuscht von ihm, besonders weil er sich in Jugendjahren engagiert auf die palästinensische Seite gestellt hatte. Von der CDU/CSU/FDP-Opposition wurde er just wegen dieser Vergangenheit im Bundestag massiv angegriffen. Als Frankfurter Straßenkämpfer habe er Polizisten verletzt, militant aufgeladen durch Palästinenserkongresse, an denen er teilgenommen hatte. Wichtige Medien steuerten ihren Teil dazu bei, den damals beliebtesten deutschen Politiker zu dämonisieren. Hier ging es urplötzlich ums Ganze. Fischer sollte demontiert, gestürzt werden. Und mit ihm Rot-Grün?
Ihn rauszuhauen wurde mein Job. Zwei Bundestags-Fragestunden lang wurde ich als Regierungsvertreter mit Fragen zu Joschkas Vergangenheit bombardiert, dann hatte ich ihn nach heftigen Rededuellen aus der Schusslinie gezogen. Meine Parteifreunde in Nordrhein-Westphalen jedoch hatten die Gefechtslage mal wieder nicht verstanden und glaubten, ich wolle Joschka ausliefern. Aufhänger war meine Aussage in der ersten Fragestunde, Fischer habe nur eine Stunde an der beanstandeten Palästinenserkonferenz teilgenommen. An der „einen Stunde“ hängten sich nun jene Medien auf, die Fischer hinrichten wollten. Einen minder schweren Fall wollten sie nicht hinnehmen. Also schlugen sie auf mich ein, ich wolle alles herunterspielen. Die Berichterstattung eines Hamburger Blatts dazu lobte ich als „unterhaltsam“, was dieses Nachrichtenmagazin als Beleidigung empfand, für die ich mich, wie im ganzseitigen Editorial gefordert, entschuldigen sollte. Meine „Freunde“ in Nordrhein-Westphalen analysierten messerscharf, ich habe die „eine Stunde“ erfunden, um, auf die absehbare Medienreaktion spekulierend, die Kampagne gegen den langjährigen Rivalen absichtlich in die Länge zu ziehen. Die Wahrheit ist: Fischer selbst hatte mir, als wir zehn Minuten Zeit hatten, die Fragestunde vorzubereiten, auf meine insistierende Frage hin gesagt, er sei nur „etwa eine Stunde“ auf dem Kongress gewesen. Die Wahrheit war hier die beste Verteidigungslinie. In NRW wurde mir daraus ein Strick gedreht.
Einige liberale Medien bereiteten nach endlosen Tagen dann Fischers öffentlichen Freispruch vor – nicht wegen erwiesener Unschuld, sondern wegen überzeugender Änderung des Lebenswandels. Letztlich rettete Joschka die Liebe des Volkes, das sich in dem ehemaligen Rabauken, der sich selbst durch harte Exerzitien zivilisiert hatte, wiedererkannte. Der verlorene Sohn gewann in der operettenhaft anmutenden Schlacht um Schuld und Sühne mehr Sympathien als seine wadenbeißenden Verfolger.
Tief verletzt hatte er vor der Fragestunde vor mir gesessen. Er war am Boden zerstört. Nicht weil er sich schuldig fühlte, dazu hatte er keinen Grund. Sondern – so mein Eindruck – er hatte gedacht, nicht nur in den Schoß der bürgerlichen Gesellschaft zurückgekehrt zu sein, aus dem er 1968 ausgebrochen war. Mehr noch, er, der ehemalige Streetfighter, das Einwandererkind aus kleinbürgerlichen Verhältnissen, hatte gemeint, jetzt als Staatsmann geradezu den ideellen Gesamtbürger zu verkörpern. Und nun wollte diese Gesellschaft ihn wieder ausstoßen!
Wir sind darüber hinweggekommen. Die Gesellschaft war reifer als manch ein Medienstratege, der umsatzsteigernd unter dem Vorwand der Pressefreiheit eine verleumderische Stimmungskampagne befeuerte. Wichtiger als die Frage nach Fehltritten wurde für die ernsthaft Interessierten die nach dem Motiv von Fischers Veränderung. Warum ist er damals nicht völlig abgedriftet? Irgendetwas in seinem Lebenslauf musste einen grundsätzlichen Wandel seiner Einstellung herbeigeführt haben. Mir sagte er, es sei Entebbe gewesen. Als 1976 palästinensische Flugzeugentführer Geiseln in jüdische und nicht-jüdische selektierten. Das habe ihn an Auschwitz erinnert, an die Rampe, und klargemacht, dass man diesen Weg nicht gehen dürfe.
Joschka Fischer, in Frankfurt aufgewachsen, hatte die Auschwitzprozesse verfolgt, hatte den Sozialphilosophen Theodor Adorno gehört und wurde von der jüdischen Gemeinde politisch nachsozialisiert. Auschwitz wurde zum Ausgangspunkt seines gesamten politischen Denkens. Es gab seinem politischen Handeln Ernst und Tiefe, verengte es aber zugleich, weil jenseits der Dimension des Holocaust die Dinge für ihn nicht immer wesentlich genug waren. Der Holocaust, der industriell betriebene Massenmord der Nazis an den europäischen Juden, war ein singuläres Verbrechen. Nicht zu relativieren durch den Vergleich mit anderen Völkermorden. Aber bedeutet das die Erlaubnis, sich Verbrechen gegenüber, die diese Dimension nicht erreichen, indifferent zeigen zu dürfen? Waren ohne die Legitimationsfigur Holocaust die Dinge nicht schlimm genug? Musste man die Militäraktion gegen den drohenden Völkermord im Kosovo unbedingt mit Auschwitz begründen, um sie überhaupt legitimieren zu können? Hat nicht mancher seinen Meinungswandel, bezogen auf militärische Gewalt, seine Wandlung vom Pazifisten zum „Bellizisten“, damit begründet, dass der Massenmord an den Muslimen in Srebrenica ihn an Auschwitz erinnere?
Fischers Rhetorik war erfolgreich, aber auch fatal. Denn sie exkulpiert alle, die ihre Augen verschließen, wenn es nicht Auschwitz ist, das droht. Und sie verengt das Denken, wenn denn eingegriffen werden muss, auf militärische Optionen. Wie aber steht es um das Recht und die Pflicht, einzugreifen bei Ereignissen, die kein Völkermord sind, sondern schlicht schreiendes Unrecht – wie etwa im Falle der Palästinenser?
Deutsche Verantwortung, deutsche Einseitigkeit
Für alle bedrängten Juden dieser Welt einen sicheren Hafen zu schaffen – spätestens seit dem Holocaust versteht sich dieses Ziel von selbst und bedeutet für Deutschland eine immer währende Verpflichtung. Einen eigenen Staat Israel zu gründen, der alle die aufnehmen will, die aus der jüdischen Diaspora in die biblische Heimatregion zurückkehren wollen – auch dieses politische Ziel, lange vor der Shoa formuliert, hat sein Recht. Aber es bedingt auch völkerrechtliche Pflichten. Denn was bedeutet es für die palästinensische Seite, für die Menschen, denen dieselbe Region seit vielen Jahrhunderten ebenfalls Heimat ist?
Die Formel der deutschen Außenpolitik nach der Staatsgründung Israels lautete: Deutschland hat eine historisch begründete besondere Verantwortung für den Staat Israel. Das war und bleibt richtig. Blendet aber die andere Seite aus, die palästinensische. Nicht allein Bundespräsident Herzog empfand hier ein Defizit. Zahlreiche Außenpolitiker aller Parteien denken ähnlich, wollen aber öffentlich nicht darüber sprechen. Ich bemühte mich in meiner Zeit, die Verantwortungsformel zu erweitern: Deutschland hat eine besondere Verantwortung für den Staat Israel – und die Folgen seiner Gründung. In mehrere Resolutionen des Bundestages floss diese Formel ein. Sie hieß nicht weniger, als dass wir uns auch um das Schicksal der Palästinenser zu kümmern hätten.
Der eigene Palästinenserstaat war allgemeiner Konsens bei den Grünen. Aber Fischer leitete dieses Ziel – und das war unsere subtile, aber gravierende Differenz – nicht aus eigenem palästinensischem Recht ab, sondern aus den Sicherheitsinteressen Israels. Israel könne langfristig nur überleben, wenn ein friedliches Palästina an seiner Seite existiere. Das hieß Zweistaatlichkeit, das hieß Palästinenserstaat. Das schien den Konsens wiederzugeben, doch perspektivisch gesehen war es einseitig. Denn die Palästinenser wollten ihren eigenen Staat nicht als Zugeständnis Israels, als rationales Kalkül dortiger Sicherheitspolitik, sondern als Ergebnis eines eigenen völkerrechtlichen Anspruchs. Sie wollten nicht abhängig sein von den innenpolitischen Stimmungsschwankungen in Israel, vom dortigen Wechsel der Strategien. Auch wenn der Endstatus gleich aussah. Weg und Begründung waren unterschiedlich. Ein Staat aus eigenem Recht oder ein Staat als Geschenk des Nachbarn? Das ist nicht weniger als der Unterschied zwischen Emanzipation und Kolonialismus. Wer den arabischen Stolz kennt, auch das tiefe Minderwertigkeitsgefühl der Palästinenser wegen der vergeudeten Jahre, der weiß, dass dieser Unterschied entscheidend ist.
Gewaltspiralen: Terror, die Mauer, Gaza
Im Februar 2004 war ich als Leiter einer grünen Delegation[iv] wieder in Israel. Ariel Sharon ließ gerade die Mauer bauen. Auf dem Weg von Tel Aviv nach Jerusalem hörten wir im Autoradio von einem entsetzlichen Selbstmordattentat auf einen Bus. Zahlreiche Fahrgäste, unter ihnen Schulkinder, waren ermordet worden. Wir fuhren sofort zum Tatort, den wir zwei Stunden später erreichten. Die Spuren waren schon fast völlig beseitigt. Wir legten einen Kranz neben die Blumengebinde. Wer das getan hatte, durfte nicht mit der geringsten Sympathie rechnen und sei sein politisches Anliegen noch so berechtigt. Mir fiel der Philosoph Ernst Bloch ein: „Im Weg muss das Ziel schon durchscheinen“, hatte er von den Reformern und Revolutionären gefordert, die von der „Dunkelheit des Augenblicks“ in die „offene Adäquatheit“ fortschreiten wollten. Das hieß im Umkehrschluss: Was im Weg durchscheint, ist das Ziel. Wer Terror verbreitet, dem kann man nicht abnehmen, dass er eine humane Zukunft anstrebt. Ein terroristischer Weg weist in eine Gesellschaft, die auf Terror gründet. Die Palästinenser verspielten die Sympathie, die ihr Elend ihnen eingebracht hat.
Dann fuhren wir weiter zur Mauer. Ein martialischer Anblick. Die Assoziation an Berlin war unvermeidlich. Die Israelis hatten den ausgebrannten Bus bewusst vor der Mauer drapiert – als „sinnstiftendes“ Zeichen. Diese Mauer sollte Selbstmordattentäter abhalten. Vielleicht erfüllt sie diesen Zweck. Zu wünschen wäre es. Aber vielleicht schürt sie auch nur mehr Hass und mehr Unverständnis. Denn sie zerschneidet palästinensische Siedlungen, schneidet Häusern den Garten und Kindern den Schulweg ab, umzingelt Siedlungen wie Bethlehem fast rundum. Sie folgt nicht der Grenze von 1967, der grünen Line, die in den internationalen Diskussionen als Grenzlinie eines eigenen Palästinenserstaates figuriert. Sie verläuft auf palästinensischem Gebiet, gemeindet illegale jüdische Siedlungen in den israelischen Staat ein. Diese Mauer mag schützen, aber sie ist ein Monument aggressiver Vorwärtsverteidigung, die der anderen Seite die Luft zum Atmen nimmt. Kurzfristig mag sie für Israel ein Sicherheitsgewinn sein, aber prinzipiell bildet sie ein weiteres Hindernis im Friedensprozess und einen Stein des Anstoßes.

Wir ließen uns die Strategie der Regierungsseite erklären, sprachen mit der israelischen Opposition. Und wir reisten nach Palästina, trafen Arafat in seinem Bunker in Ramallah – einer der letzten internationalen Kontakte vor seinem Tod. Wir waren keine Anhänger Arafats, wussten, zu welchen Winkelzügen er fähig war. „In Englisch, nach Westen, redet er als Taube, in Arabisch Richtung Osten als Falke“, warfen seine Gegner ihm vor. Aber man brauchte nur nach Bethlehem zu fahren oder in den Gazastreifen, um die verzweifelte Lage der Palästinenser zu erkennen. Und wenn Arafat mit seinem doppelten Gesicht sich nicht durchsetzte? Konnte er überhaupt eindeutig einen Verständigungsfrieden propagieren, wenn Israel es nicht dankte? Musste er nicht durch Rhetorik versuchen, ein Überlaufen der frustrierten Massen zur radikalen Hamas zu verhindern? Heute sind seine früheren Kritiker klüger.
Gaza wäre, so dachten wir bei unserem Besuch, selbst wenn Israel die Siedlungen räumen würde, für sich genommen nicht lebensfähig. Auch die begleitenden Direktoren des UNO-Hilfsprogramms waren mehr als skeptisch. Sie waren froh, dass deutsche Politiker endlich einmal ins Zentrum der Probleme schauten, sich ihre unverblümten Analysen anhörten. Und sie hatten große Sorge: „Gaza wird zum Ghetto. Es ist von israelischem Gebiet umgeben, aber abgeschnitten von den dortigen Arbeitsplätzen, kann sich nicht selbst versorgen. Es wird am Tropf der internationalen Gemeinschaft hängen, ein Sozialhilfefall. Wir zahlen die Zeche, und hier entsteht eine neue Brutstätte für Militanz.“ Die Sorge konnte man teilen. Wir versuchten, Hamas-Sympathisanten den Terror auszureden. Aber auch Gemäßigte beklagten, ohne eine Räumung der Siedlungen auch in der Westbank und ohne Verbindung des Gaza-Streifens mit dem Westjordanland würde es keine Lösung geben.
Der Sharon-Plan
Dies ist der springende Punkt. Welches strategische Ziel verfolgte Scharon? War die damals angekündigte Räumung des Gazastreifens der Auftakt zu einer ernsthaften Zweistaatenpolitik? Würde die weitgehende Räumung der Westbank folgen? Oder ging es darum, Druck abzulassen, den Gazastreifen aus Gründen der Frontverkürzung zu räumen, um die Westbank umso fester halten zu können? Und die illegalen Siedlungen rund um Jerusalem? Um von einem palästinensischen Flecken durch israelisch kontrolliertes Gebiet zum anderen, um von Stadt zu Stadt zu kommen, benötigten die Palästinenser Passierscheine. Das galt selbst für ihre Parlamentarier, die zu offiziellen Terminen nach Ramallah wollten! Wie sollten sie so eine Demokratie aufbauen? Autonomie von Israels Gnaden, das konnte nicht die Lösung sein. Separierte Entwicklung von zwei Gesellschaften auf demselben Territorium – kannten wir das nicht aus einer anderen Weltgegend?
Im israelischen Friedenslager zirkulierte ein Papier, der sogenannte „Scharon-Plan“. Er war über 10 Jahre alt. Zu sehen war die Westbank mit roten Punkten und einem dicken schwarzen Strich. „Das sind die Siedlungen und die Mauer. Alles von langer Hand geplant, um die Westbank einzugemeinden“, lautete die Analyse der „Peace now“-Aktivisten. „Er wird Gaza räumen und in einem Zustand hinterlassen, der ihm als Beweis für die Unfähigkeit der Palästinenser zur Selbstverwaltung dient. Darauf gestützt wird er die Westbank unter Kontrolle halten.“
Böse Spekulation? Scharons Strategie der einseitigen Maßnahmen war ein Indiz dafür, dass diese Befürchtung berechtigt war. Hätte er den Rückzug aus dem Gaza-Streifen nicht einseitig verkündet, sondern mit den gemäßigten Palästinensern, mit der Fatah, verhandelt, wie wir Europäer ihm dringend nahelegten, so hätte er diese zugleich gestärkt. Sie hätten den israelischen Abzug als Ergebnis ihrer verständigungsorientierten Politik ausgeben können. In den Augen der palästinensischen Bevölkerung hätten Verhandlungen der Fatah mit der israelischen Regierung Fortschritte gebracht. So aber konnte die Hamas profitieren. Sie brach in Triumphgeheul aus und behauptete, ihre militante Politik habe die Israelis vertrieben und den Sieg gebracht. Wie schon vor einigen Jahren, als Israel sich aus dem Südlibanon zurückzog, was von palästinensischer Seite nicht gedankt wurde.

Ob dieser Effekt in Scharons Absicht lag? Jedenfalls konnte er anschließend verkünden, über die Westbank gebe es nichts zu verhandeln, weil auf der anderen Seite ernsthafte Gesprächspartner fehlten. Für Uri Avnery – inzwischen greiser Held des Exodus und der Gründungskriege, der damalige „Terrorist“ und heutige Friedenskämpfer, unser Freund und Berater – war bei unserem Besuch die Sache klar: Scharon plane parallel zur Freigabe Gazas die Annexion der Westbank.
Mit der Hamas zu reden ist eine Zumutung. Viele dort propagieren einen Sieg über Israel und glauben auch daran. Nicht unbedingt sofort, nicht unbedingt militärisch, nur hin und wieder hört man, die Juden müssten ins Meer zurückgetrieben werden. Die meisten setzen auf den demographischen Faktor. Raketen auf Israel dienen dazu, Zeit zu schinden, einen Frieden zu verhindern, damit der demographische Faktor Wirkung entfalten kann. Die Geburtenrate der Palästinenser ist enorm hoch, in ein, zwei Jahrzehnten wird die Gesamtzahl der Nicht-Juden im Gebiet von Israel plus Westbank die der jüdischen Bewohner übertreffen. Was dann?
Die Zukunft: Zweistaatlichkeit oder Sieg? Demokratie oder Apartheid?
Sollte Israel keine zwei unabhängigen Staaten zulassen, mit einer jüdischen Bevölkerungsmehrheit im heutigen Kernland, sondern die Kontrolle über die Westbank erhalten wollen, dann gäbe es folgendes Szenario: Entweder wäre Israel demokratisch oder es wäre jüdisch. Entweder ließe man eine palästinensische Mehrheitsbildung zu und verlöre damit die jüdische Prägung des Staates oder man setzte das Judentum durch auf Kosten der Demokratie. Theodor Herzls Vision jedenfalls von einem jüdisch-demokratischen Israel, von Erez Israel, wäre verspielt. Und das Westjordanland würde als halbautonomes Gebiet, mit eigener Verwaltung, aber ohne gesamtstaatliche demokratische Rechte mitgeschleppt? Bantustan, Homeland – vergleichbare Pläne hatten schon im Südafrika der Apartheid keinen Bestand.
Auch auf israelischer Seite gibt es Fantasten eines Siegfriedens. Bei unserer Reise trafen wir eine Sprecherin der Partei russischer Einwanderer, eine freundliche, gemütlich wirkende Frau. Das Gespräch über die Lebenslage in Israel, die Arbeitslosigkeit, den geplagten Mittelstand, den inneren Rassismus plätscherte dahin, bis sie mit ihrem Vorschlag zur Palästinenserfrage aufwartete: Putin, Tschetschenien, Flächenbombardierung…es war manchmal schwer für uns, die Contenance zu wahren.
Eine isolierte Stimme? Was soll man von folgender Szene halten? Botschafter Avi Primor, der Friedensstratege, der Glücksfall für die israelisch-deutschen Beziehungen, und sein Team waren vom konservativen Likud abgelöst worden. Ein neuer ranghoher israelischer Diplomat machte seinen Antrittsbesuch bei mir im Auswärtigen Amt. Ohne Umschweife kam er zur Sache. Sinngemäß: „Das ganze Hin und Her der Verhandlungen bringt doch nichts. So geht es seit Jahrzehnten. Warum nicht eine radikale und endgültige Lösung? Warum sollen die Palästinenser überhaupt auf der Westbank bleiben, eine energische Aktion, und sie sind draußen. Das dauert ein paar Wochen, das muss die Welt aushalten, aber dann ist Ruhe und alle gewöhnen sich daran. Tun sie doch immer. Was würde Deutschland davon halten?“ Ich lehnte entschieden ab, schaffte es noch, das Gespräch zu einem höflichen Ende zu bringen. Diplomatisch bestimmt unkorrekt, habe ich mit diesem Herren, der ein ganzes Volk deportieren wollte, nie mehr ein Wort gesprochen.
Es ist schwierig für uns Deutsche, angesichts des Holocaust hier die richtigen Worte zu finden. Die israelischen Falken haben die Erfahrung gemacht, dass sie uns mit diesem Argument immer wieder zum Schweigen bringen, zur Loyalität zwingen können. Die Araber dagegen verlangen von uns, diesen „Komplex“, wie sie es nennen, zu überwinden. Die Wahrheit muss irgendwo dazwischen liegen. Verantwortung für den Staat Israel und die Folgen seiner Gründung – wir haben die Verpflichtung, auch den Palästinensern zu ihrem Recht zu verhelfen, wie den Israelis zu ihrem gesicherten Frieden.
Nicht alle in der arabischen Welt meinen es gut, wenn sie uns Ratschläge geben. Gerade wenn man sich etwas näher einlässt, wenn es familiärer wird, die Gespräche offen werden, hört man so manche bizarre Äußerung: „Ihr Deutschen und wir Araber wissen, wie man mit Juden umzugehen hat.“ Widerwärtig. Bei solch empörenden Äußerungen ist unzweideutige Distanzierung angesagt. Keine Kumpanei mit Antisemiten! Wie weit geht diese Haltung in der arabischen Welt? Leider ist sie zu häufig anzutreffen.
Die offiziellen Äußerungen sind milder geworden. Die Arabische Liga hat angedeutet, Israel anzuerkennen und damit auch seine Sicherheit zu akzeptieren, wenn Israel umgekehrt den palästinensischen Anspruch anerkennt. Es gibt also zumindest die Bereitschaft zur Duldung. Wenn dem Bekenntnis aber nicht entsprechende Taten folgen, können die unterschwelligen, teils gruseligen Stimmungen leicht wieder überhand gewinnen. Unabdingbar aber sei, so ist allenthalben zu hören, ein Stopp der israelischen Siedlungspolitik.
Jemen und Saudis – nahe Nachbarn, ferne Welten
Mai 2002, Jemen. Acht Monate nach den Terrorangriffen auf die USA. Mit Trommelwirbel und Flötentönen werde ich von einer einheimischen Kapelle prozessionsmäßig durch die Straßen der Hauptstadt Sanaa geleitet. Die mittelalterlichen Wolkenkratzer aus Lehm wurden zum Weltkulturerbe erklärt. Hoher Besuch aus Deutschland ist hier gern gesehen. Der Präsident versichert mir im Gespräch: „Wir sind das Kernland Arabiens, Ausgangspunkt der arabischen Identität. Mit Al Qaida haben wir nichts zu tun.“ Es ergibt sich die Gelegenheit, verdeckte Gespräche mit Frauenrechtlerinnen zu führen, unter deren schwarzen Ganzkörperschleiern Gucci-Jeans und Prada-Schuhe hervorlugen. „Die Männer missbrauchen den Koran als Vorwand für unsere Unterdrückung. Wir arbeiten an einer islamischen Aufklärung.“ Es folgt der Besuch in den Gemächern eines angesehenen Scheichs, der mir nach opulenter Beköstigung der ganzen Delegation eine Geheimbotschaft an den Bundeskanzler zusteckt. Vorsichtshalber öffne ich den Brief, bevor er den Kanzler erreicht. Schröder möge bitte eine Revolution im Jemen unterstützen und ihn, den Scheich, einen direkten Nachfahren Mohammeds, als rechtmäßigen Herrscher Arabiens an die Macht bringen. Der Kanzler wird das Schreiben nie zu Gesicht bekommen, entscheide ich.
Das Grenzgebiet zu Saudi-Arabien, formell jemenitisches Staatsgebiet, ist faktisch unregierbar. Aus dieser Ecke stammen Bin Laden und viele seiner Terrorhelfer. Hier gräbt das Deutsche Archäologische Institut, das aus Mitteln des Auswärtigen Amts finanziert wird, die alte Königsstadt Saba aus. Das muss inspiziert werden. Also fahren wir in die Wüste. Assoziationen an Georg Friedrich Händels „Salomon“ und an Märchen aus 1001 Nacht mischen sich mit einem höchst mulmigen Gefühl, als wir die Stadt verlassen. Meine kleine Delegation in einem normalen PKW, hinter uns die Sicherheit, ein Pickup mit aufmontiertem Maschinengewehr. In halsbrecherischer Fahrt geht es durch die Schluchten, das MG im Nacken. Alles geht gut. Wir sehen die Ruinen von Saba. Sicherung von Kulturdenkmälern ist für uns Teil des Kulturdialogs, der Völkerverständigung. Angst vor einer Entführung haben wir nicht, eher vor unseren Beschützern. Hinter uns gerät der Pickup auffällig ins Schlingern, als wir zurückfahren. Heftig fuchtelt seine Besatzung mit dem MG herum, macht Zielübungen in alle Richtungen. Haben sie Qat genommen? Regelmäßig zur Mittagszeit, so berichtet unser Botschafter, beginne halb Jemen diese Pflanze zu kauen, die in rauschhafte Stimmung versetze. So lange, bis keiner mehr arbeiten und gut und böse richtig voneinander unterscheiden könne – sicherlich mit ein Grund für die miserable Produktivität des Landes und seine Unberechenbarkeit in politischer Hinsicht.
Zum Abschied in Sanaa spreche ich außerhalb des Protokolls meinen direkten Counterpart an, einen smarten, in westlichem Stil gekleideten Mann: „Stimmt es, dass die Hamas im Jemen besonders viel Geld sammelt?“ „Wir sind das Kernland Arabiens. Alle kommen gern. Sie ja auch. Und alle guten Muslime geben Almosen, wie der Koran es verlangt.“ „Wenn die Hamas auf dieses Geld angewiesen ist, können Sie dann nicht darauf drängen, dass sie die Selbstmordattentate einstellt?“ „Wir haben keinen Einfluss darauf.“ „Können Sie nicht wenigstens darauf drängen, dass sich die Hamas auf militärische Ziele beschränkt?!“ „Würde Europa Hamas dann wertschätzen?“ „Das nicht, aber die Palästinenser würden nicht alle Sympathien verspielen.“ „Warum fordert ihr nicht von Israel, die besetzten Gebiete zu räumen?“ „Wir Deutsch…“ „Wir mögen euch Deutsche, wir verstehen uns gut. Aber ihr müsst wieder selbstbewusster werden.“ „Wir haben eine besondere Verantwortung…“ „Wir auch…“
Wie verhasst die USA in der arabischen Welt sind, erlebte ich bei einer Diwania in Kuwait. Ich hatte das Privileg, als ausländischer Gast an dieser traditionellen Männerversammlung teilnehmen zu können. Dort saßen sie alle im viereckigen, weißgetünchten Raum auf Steinbänken, an die Wand gelehnt, in weißem Burnus und weißem Turban, Männer, die tagsüber im Nadelstreifen des Bankiers, im feinen Zwirn des Diplomaten, im Kaftan ihres Hausmeisters oder in der traditionellen Kleidung der Bauern zu sehen sind. Hier hatte jeder das Recht, ohne Ansehen des Berufsstandes und der Person, offen seine Meinung zu sagen. Das hier war Arabien live. Ungeschönt, unverstellt. Mir klingelten die Ohren. Selbst hier in Kuwait, das die USA von der irakischen Invasion befreit hatten – nur Wut, Wut, Wut! Doch hinter der Wut auf die USA wurde auch der Selbsthass sichtbar. Und die Hoffnung auf Europa.
Der Hauptvorwurf der Araber an die westliche Welt lautet: „Ihr habt doppelte Standards. Ihr setzt die Regeln, die ihr aufstellt, nicht gleichermaßen gegenüber allen durch.“ Zielscheibe der Kritik sind vor allem die USA, aber auch wir Europäer kommen nicht ungeschoren davon, weil wir den USA nicht genügend eigenes Profil entgegensetzten. Atomare Rüstung in der arabischen Welt werde bekämpft – das Atomwaffenarsenal Israels toleriert. Antisemitismus werde angeprangert, die Vertreibung der Palästinenser aber hingenommen. Ein Staat Israel werde anerkannt, das Staatenbildungsrecht der Palästinenser unterlaufen. Ganz von der Hand zu weisen ist diese Kritik nicht. Doch auch die Araber haben ihre doppelten Standards: Immer wieder betonen sie gegenüber ihren Kritikern, der Islam sei eine Friedensreligion; doch nach den Freitagsgebeten sammeln sie Geld für die Hamas.
Algerien und Libyen – zwischen Terror und Demokratie
Dass sich der Dialog lohnen kann, zeigte mir frühzeitig das Beispiel Algerien. Zehn Jahre lang war es aus dem Blick Europas geraten. Die FIS, eine islamistische Partei, drohte 1991 die demokratische Nationalwahl zu gewinnen. Militärs putschten gegen die sich abzeichnende Mehrheit. Deren Anhänger radikalisierten sich weiter, zogen als Terrorbanden, unterstützt von „afghanischen Arabern“, mordend durchs Land und massakrierten zehntausende Menschen. Die „Sicherheitskräfte“ gingen nicht weniger brutal vor; auch viele Unschuldige fielen extralegalen Hinrichtungen zum Opfer. Das Land geriet in einen schmutzigen Bürgerkrieg. Europa in der Klemme: Sollte es die Wahl und damit die Islamisten anerkennen oder die Wahl und damit die Demokratie negieren? Europa hatte sich einfach abgewendet. Ende der neunziger Jahre übergab das Militär die Macht wieder der FLN, der Nationalen Befreiungsfront, die Jahre zuvor die Mehrheit verloren hatte.
Nun, im Juni 2000, war ich der erste ranghöhere europäische Politiker, der wieder nach Algier reiste. Demonstrativ dehnte Präsident Abd Al-Aziz Bouteflika das Gespräch auf drei Stunden aus, beklagte sich über die europäische Passivität. Er hatte sich mit dem Militär verbündet und – so seine Sicht – dem fundamentalistischen Terror ein Ende gemacht. In Algier konnte man sich wieder halbwegs sicher bewegen, auch wenn die Deutsche Botschaft noch einer Festung glich. Beim Niederkämpfen der Dschihadisten war es auch zu Menschenrechtsverletzungen gekommen. Zweifellos. Als Bouteflika auf meine Anregung hin einige Monate später von Schröder in Berlin offiziell empfangen wurde, sparte auch der Kanzler das Thema Menschenrechte nicht aus. Aber wie wohlfeil ist manchmal europäische Kritik. Bei uns ziehen keine marodierenden Banden durch die Häuser, um nächtens den Menschen die Kehle durchzuschneiden. Der algerische Präsident jedenfalls fühlte sich zu Unrecht von Menschenrechtsorganisationen angegriffen: „Lautstark verurteilen sie, wenn die Militärs in einer extrem schwierigen Lage zu hart zuschlagen. Die zehntausendfachen brutalen Morde durch die Fundamentalisten fallen unter den Tisch. Wie hätten wir derer denn Herr werden sollen? Das hättet ihr mit eurer Polizei und eurem Rechtsstaat nie geschafft!“ Zumindest was die Einseitigkeit angeht, hatte der Präsident nicht ganz Unrecht. Denn Menschenrechte verletzen kann im völkerrechtlichen Sinne nur ein Staat. Eine kriminelle Bande ist kein Staat, ihre Gewalttaten fallen nicht unter den Begriff. Also haben Menschenrechtler sie oft nicht in ihren Anklageschriften.
Auch mit Libyen, das bei der Befreiung der Jolo-Geiseln „gute Dienste“ geleistet hatte, suchten wir einen Neuansatz. Mein Gegenüber dort war Vizeaußenminister Mujber, der Gaddafi besonders nahe stand, als sein außenpolitischer Berater galt. Er war ein alter Kampfgefährte aus der Zeit der antikolonialen Bewegung. Danach aber hatte er sich offensichtlich eingeigelt; sein Weltbild strotzte vor irrealen Vorstellungen. Vier Stunden lang diskutierten wir! Es ging nicht um den Austausch von Standardfloskeln. Nein, in einem gemeinsamen Diskurs suchten wir die gesamte Kolonialzeit, die Geschichte der Befreiung und alle möglichen Entwicklungs- und Revolutionstheorien aufzuarbeiten. Mujber wollte sein Weltbild abgleichen und suchte in mir einen Sparringspartner, der auf der Ebene der politischen Philosophie mithalten konnte. Er spürte, dass meine Sympathien den Befreiungsbewegungen gehörten. Aber ich ließ auch keinen Zweifel daran, dass ich das aktuelle Ergebnis der libyschen Selbstbefreiung für suboptimal hielt. Die Libyer mussten raus aus ihrer Isolation, weil sie sonst die Chance auf Weiterentwicklung verspielten.
Mein Gegenüber wurde hellhörig. Libyen zeigte nach vielen Seiten Goodwill und brauchte endlich eine Rückmeldung, einen Dialog. In der Führung konkurrierten zwei außenpolitische Linien: Die eine schaute nach Afrika, die andere nach Europa. Gaddafi hatte maßgeblichen Anteil an der Gründung der Afrikanischen Union, wollte dort Leitfigur werden. Andere, modern eingestellte Technokraten, richteten den Blick eher nach Europa. Ich stellte die Frage, warum Libyen nicht beides tun könne, nämlich Scharnier werden zwischen Europa und dem afrikanischen Kontinent. Nicht alleine, sondern gemeinsam mit den anderen Staaten der Arabisch-Maghrebinischen Union[vi], die dafür wiederbelebt werden könne.
Der Libyer hörte sehr aufmerksam zu. Zum Schluss war er nicht mehr davon überzeugt, dass die ESVP, die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, vorhatte, Afrika erneut zu überfallen und kolonial zu unterjochen. Er war auch nicht mehr überzeugt, dass Europa die Kleinwaffen, mit denen sich in Afrika die Leute scharenweise abmurksten, durch die UNO einsammeln lassen wollte, um den Kontinent verteidigungsunfähig gegen den europäischen Imperialismus zu machen. Er begann mit der europäisch-afrikanischen Brückenrolle zu liebäugeln. Wollte mit Gaddafi darüber reden. Ich lud ihn nach Deutschland ein. Etwas ungelenk sein Auftritt in Berlin, sein erster Besuch in Westeuropa überhaupt. Außer mir empfing ihn niemand. Wir empfanden uns als Pioniere in einem Dialog, der fällig, aber noch nicht „angesagt“ war.
Das libysche Engagement bei der Befreiung der Jolo-Geiseln hat sich ausgezahlt. Nicht nur für die befreiten Menschen, nicht als vordergründiger Prestigegewinn für Libyen. Sondern als wichtiger Schritt der Reintegration des Landes in die internationale Staatengemeinschaft. Die Altlasten wurden recht schnell endgültig geklärt. Das UNO-Embargo gegen Libyen wurde fallen gelassen. Sogar die USA haben ihre Beziehungen normalisiert. Gaddafi unterstützte sie im Kampf gegen den Terrorismus. Leider hat der libysche Diplomat Azzarouk, der die entscheidenden Verhandlungen zur Geiselbefreiung führte, trotz meiner Anregung kein Bundesverdienstkreuz erhalten.
Der „arabische Frühling“: demokratische Hoffnung, religiöses Rollback, Staatszerfall
Dieser hoffnungsvolle Neubeginn mit Libyen, den damals alle westlichen Staaten anstrebten, ist gerade einmal zehn Jahre her, als der „arabische Frühling“ ausbricht und die Emanzipationsbewegung auch Libyen ergreift. Gadaffis Reaktion war vor dem Hintergrund arabischen Stammesdenkens nachvollziehbar, gemessen an westlichen Werten und Demokratieidealen jedoch inakzeptabel. Wenn man aber persönlich an dem nicht ganz erfolglosen Versuch beteiligt war, das verirrte Libyen in die Völkergemeinschaft zu reintegrieren, dann bedrückt es doch, wie schnell und scheinbar leichtfertig westliche Mächte dabei mitgewirkt haben, nicht nur seiner Herrschaft, sondern auch seinem Leben ein Ende zu setzen.
Warum hofierte der Westen Gaddafi so lange, den er je nach Gefechtslage als Terroristen, abgedrehten Folkloreprinzen oder verdienstvollen Begründer der Afrikanischen Union darstellte? Ausschlaggebend waren nicht westliche Werte, sondern Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen. Erst war es das Öl, dann der Kampf gegen den Terror. Dann die Zusammenarbeit bei der Abwehr von afrikanischen Flüchtlingen, die über das Mittelmeer nach Europa wollten. Zusammengefasst: Stabilität. Nicht nur in Libyen, in der gesamten arabischen Welt waren Despoten an der Macht, die Helden der Dekolonisierungskämpfe oder ihre politischen Erben. Despotien bedeuten Ordnung. Die Machthaber hatten versucht, moderne Nationalstaaten zu bilden und die Vision einer panarabischen Nation am Leben zu halten. Als säkulares Projekt, nicht als religiös-islamistisches! Im Ost-West-Konflikt mal auf dieser, mal auf jener Seite. Im „Barcelona-Prozess“[vii], ihrem Dialog mit den Mittelmeeranrainern, hatte die Europäische Union seit langem auf Wandel durch Annäherung gesetzt. Das Mittelmeer sollte „mare nostrum“, euro-arabisches Binnenmeer sein, wie in der Antike. Besonders die südeuropäischen EU-Partner legten Wert darauf als Ausgleich für den wirtschaftlichen Gewinn, den die Nordstaaten durch die Osterweiterung der EU einfuhren.
Ich erinnere mich, wie ich auf einem der Barcelona-Treffen mit Uri Avneri, der für Israel den Dialog suchte, zusammenstand. Wir waren uns einig: Mit ihren Despotien hielten die arabischen Potentaten Völker zusammen, die von den Kolonialmächten, ohne gefragt zu werden, in einen gemeinsamen Staat zusammengepfercht worden waren. Nicht alles, was zusammenkam, gehörte zusammen. Die Despoten hielten die Fiktion aufrecht, die ehemaligen Kolonien könnten nach Gewinn der Souveränität als Nationen in denselben Grenzen weiterleben. Die Fiktion trug zur Sicherheit bei, auch für Israel, wenn auch zu einer trügerischen. Was würde geschehen, wenn Zentrifugalkräfte die Staaten auseinanderrissen? Die Umwälzungen in der arabischen Welt machen deutlich, dass Machtverschiebungen zugleich Destabilisierung und regionale Unsicherheit bedeuten können.
Schnell hat der Westen dann die demokratischen Modernisierer unterstützt, als diese nach Revolution riefen. Diese Umwälzung konnte, so das Kalkül, in kurzer Zeit eine neue, pro-westliche Stabilität bringen. Und nun ist er verdutzt, weil dem Sturz der Despoten nicht automatisch eine Demokratie nach westlichem Muster folgt. Warum auch? Der Sturz gelingt nur mit einer breiten politisch-gesellschaftlichen Koalition – einer positiven, weil die Bündnispartner eine gemeinsame Vision haben, oder einer negativen, die sich nur darin einig ist, dass das Alte weg muss. Der Westen hat auf die erste Variante spekuliert und die zweite bekommen. Wer die Diadochenkämpfe nach dem Sturz der Herrscher gewinnt, ist offen. Es können andere Gruppen aus dem abgewirtschafteten Establishment sein, die endlich in die Paläste wollen. Es können Stämme sein, die bisher unterdrückt wurden und nun ihre Unterdrücker unterdrücken wollen. Es können natürlich auch die aufgeklärten Modernisierer sein, mit denen der Westen sympathisiert. Aber auch deren Gegenteil: islamistisch-archaische Eiferer, die von der Despotie ebenso unterdrückt waren wie die Progressiven. Oder es folgen Anarchie, Staatszerfall, regionale Neuordnungskriege. Es ist keinesfalls ausgemacht, dass die reale Alternative zur Despotie die Demokratie sein wird.
Dem Westen blieb der Jubel über den „Frühling“ jedenfalls schnell im Halse stecken. Nicht nur, weil er sich vor die Frage gestellt sah, ob er militärisch eingreifen sollte. Während er im Falle Libyens seinen alten Feind-Freund Gaddafi schnell über die Klinge springen ließ, fällt es ihm im Falle Syriens schwer, überhaupt Gut und Böse richtig auseinanderzuhalten. Im Kampf gegen Assad Bündnisse mit Islamisten eingehen, die sich nach einem Sturz vielleicht noch schlimmer gebärden? Und dabei Russland brüskieren? Oder zusehen, wie die Opposition massakriert wird?
Bei Revolutionen geraten zwei westliche Politikziele in Widerspruch: Demokratisierung versus Stabilität. Deshalb favorisiert der Westen eigentlich eher evolutionäre Reformen statt Revolutionen. Dazu aber passt nicht der Jubel über eine durch den Schmutz gezogene Despotenleiche. Zumal die Anhänger des Gestürzten sich nicht geschlagen gaben. Sie radikalisierten sich, vermischten sich mit Dschihadisten und verlagerten den Krieg nach Mali. Was sollen arabische Despoten in Zukunft von westlichen Dialogangeboten halten, nun, da sie erlebt haben, dass das freundlich scheinende Gespräch jederzeit in eine tödliche Attacke umschlagen kann.
Kulturdialog heißt nicht, Arabern nach dem Munde zu reden. Aber mit Belehrungen kann man ihnen nicht kommen. Auf zahlreichen Reisen in die arabische Welt, bei ausgedehnten Dinnern an überladenen Tafeln, beim Empfang in Privatgemächern von Scheichen, in der Männerrunde der Diwania, ja, sogar bei halbkonspirativen Frauenversammlungen konnte ich dies erfahren. Man muss die Globalisierung gar nicht zum Maßstab für Entwicklung nehmen. Man muss auch nicht unseren europäischen Modernisierungsbegriff zugrundelegen. Die Araber wissen selber, dass sie in einer vergangenen Epoche leben. Die einen finden es gut und richten sich aggressiv gegen uns modernistische Ruhestörer, andere verharren fatalistisch in der Bewegungslosigkeit. Unglücklich sind sie alle, dass ihre Region, die in den Jahrhunderten, da Europa im finsteren Mittelalter versank, der Welt so viel Neues in Mathematik, Medizin und Architektur beschert und zudem die europäischen Schriften des klassischen Altertums gerettet hat, heute so wenig Respekt genießt. Nur wenige wollen energisch zu neuen Ufern.
Ob dies auf den Einfluss des Islam zurückzuführen ist? Darüber mögen die Gelehrten streiten. Denn es gibt ja auch Gegenbeispiele: das iranische Atomprogramm. Der Massentourismus in Tunesien. Die Boomtowns Dubai und Doha. Die Emirate haben das Glück, dass ihnen bald das Öl ausgeht. Sie wissen, dass sie die Erlöse investieren müssen in Modernisierung, Diversifizierung und langfristige Wirtschaftsstrategien. Also kann nicht der Islam das Entwicklungshindernis sein. Eher ist es das Öl, das genügend Einnahmen bringt, so dass gesellschaftliche Reformen überflüssig erscheinen. Die alten feudalistischen Machtstrukturen werden verfestigt. Der traditionelle Zeitbegriff des Nomadendaseins in der Wüste muss sich nicht an die modernen Taktgeber in den Prozessoren der Computer anpassen. Die Gesellschaften verharren bewegungslos.
Die „Genfer Initiative“ – ein letzter Versuch?
Ende der 1980er Jahre gab es Visionäre für den Nahen Osten. Shimon Peres und Jassir Arafat hatten beide dieselbe Idee. Israel, Palästina und Jordanien sollten, wie die Beneluxländer, eng zusammenarbeiten, den Kern einer integrierten Wirtschaftsregion Nahost bilden. Das war ein faszinierendes Entwicklungsmodell. Wenn man hierhin doch wieder zurückkommen könnte!
Es gibt Kräfte in beiden Lagern, die dies wollen. Die sogar den Lagerbegriff aufgelöst haben. In Genf haben sie am 1. Dezember 2003 eine gemeinsame Initiative begründet, friedenswillige Israelis und friedenswillige Palästinenser. Sie sind alle Streitfragen durchgegangen und haben für jedes einzelne Problem eine Lösung erarbeitet. Friede wäre möglich. Ein Verhandlungsfriede auf der Basis eines gerechten Interessenausgleichs. Aber warum hat die „Genfer Initiative“, getragen vom ehemaligen israelischen Justizminister Jossi Beilin und dem palästinensischen Informationsminister Jassir Abed Rabbo, so wenig Unterstützung bekommen?[viii] Auch Fischer reagierte nur halbherzig, als ich sie im Namen der Koalitionsfraktionen in den Bundestag einbrachte, wo sie mehrheitlich begrüßt wurde. Sie war kein Gegenmodell zur „Road Map“ der internationalen Gemeinschaft, sondern eine konkrete Ausgestaltung.
Zu viele Hardliner stehen dagegen, die ihr innenpolitisches Gewicht in gleichermaßen korrupten Gesellschaften aus der Feindschaft mit dem Nachbarn ableiten. Vielen ist die Gefahr zu groß, dass die Verständigung mit der anderen Seite so gravierende Brüche auf der eigenen provoziert, dass es zum Bürgerkrieg kommt. Im einen wie im anderen Land. Lieber Krieg zwischen den Staaten und Frieden im Inneren als zwischenstaatlicher Friede und Bürgerkrieg im eigenen Land. Für die Welt aber und für den Kampf gegen den internationalen Terrorismus ist dies keine Lösung.
„Der Nah-Ost-Konflikt ist nicht lösbar“, hat Henry Kissinger einmal sinngemäß gesagt, „er kann nur mit größtem Aufwand ständig in der Balance gehalten werden.“ Die internationale Gemeinschaft ist jedoch eher bereit, ihren Teil zu einem nachhaltigen Frieden beizusteuern als zur Aufrechterhaltung des Status quo. Ein Verhandlungsfriede wird nicht zu sichern sein ohne die Stationierung von internationalen Beobachtern, von Blauhelmen. Dies wäre ein denkbarer Auftrag auch für die Nato, im Namen der UNO. Eine Überlegung, die auch bei der deutschen Entscheidung gegen den Irakkrieg wesentlichen Einfluss hatte: Wenn die Nato wirklich dazu beitragen will, einst einen Frieden im Nahen Osten zu sichern, dann darf sie sich nicht durch einen Willkürkrieg gegen den Irak in den Augen der arabischen Welt unmöglich machen. Durch Friedenssicherung im Nahen Osten könnte die Nato einen effektiveren Beitrag zum Kampf gegen den Terrorismus leisten. Aber ob ein Frieden zustande kommt, liegt in erster Linie in der Hand der Führungsmacht USA.
Nachtrag Dezember 2012: Gerade hat der deutsch-jüdische Wissenschaftler Micha Brumlik das Konzept der Zweistaatlichkeit für endgültig gescheitert erklärt[ix], gescheitert an der israelischen Siedlungspolitik, die de facto die Errichtung eines palästinensischen Staates unmöglich mache. Man müsse für die Zukunft von einem einzigen Gebiet ausgehen. Wenn er recht hat, dann gibt es in Zukunft, wie an anderer Stelle bereits ausgeführt, nur noch diese Alternativen: Entweder ist der neue Gesamtstaat demokratisch – dann aber wird er wegen des palästinensischen Bevölkerungswachstums bald seine jüdische Prägung verlieren. Oder er ist jüdisch bestimmt, dann wird es Apartheid statt Demokratie geben.
[i] 1993 hatte ich als Parteivorsitzender gemeinsam mit Marianne Birthler die offiziellen Parteibeziehungen zum Zentralrat der Juden in Deutschland unter dem Vorsitz von Ignaz Bubis hergestellt (nachdem insbesondere Antje Vollmer immer wieder informelle Kontakte gesucht hatte).
[ii] Herzog, Roman (2007): Jahre der Politik. Die Erinnerungen, München, S. 359.
[iii] Vgl. dazu Volmer, Ludger (1998): Die Grünen und die Außenpolitik – ein schwieriges Verhältnis, Münster, Kap II 6.3 und III 3.3.
[iv] Mit Marianne Tritz MdB und dem Nah-Ost-Experten Jörn Böhme, vor Ort begleitet von Christian Sterzing, Ex-MdB (Heinrich-Böll-Stiftung Ramallah) und Julia Scherf (Heinrich-Böll-Stiftung Tel Aviv).
vi] Außer Libyen sind das Tunesien, Algerien, Marokko, Mauretanien.
[vii] Der Barcelona-Prozess hat einen erfreulichen Nebenaspekt: Deutschland liegt am Mittelmeer!
[viii]Jassir Arafat erklärte mir gegenüber bei einem späteren Treffen, er habe von der Initiative gewusst und sie gebilligt. Von israelischer Seite sind mir keine ähnlichen Äußerungen bekannt. Vgl. zum Gesamtkomplex Perthes, Volker (2003): Geheime Gärten. Die neue arabische Welt. Berlin, S. 177ff.
[ix] Micha Brumlik (2012): Siedlungen gefährden Israels Demokratie, in: Süddeutsche Zeitung, 3. Dezember 2012.