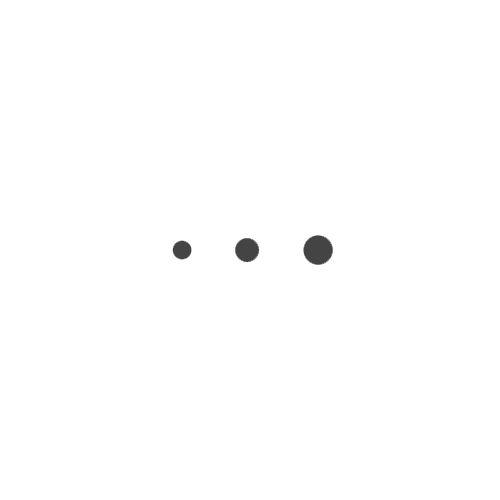(erschienen in: Sicherheit und Frieden, 1/1996, Vierteljahresschrift für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, unter dem Titel „Gemeinsame Sicherheit durch ökologisch-solidarische Strukturpolitik“)
Gemeinsame Sicherheit durch ökologisch-solidarische Strukturpolitik
I. Einleitung
Wer sich in der heutigen Zeit daranmacht, eine umfassende sicherheitspolitische Konzeption zu entwickeln wie das der Europäischen Sicherheitsgemeinschaft (ESG), erwirbt sich Verdienste, auch wenn vieles zum Widerspruch reizt. So fragt mancher grundsätzlich, ob es denn überhaupt legitim sei, Modelle zu entwickeln, während sich Außenpolitik doch hauptsächlich real entlang der tagespolitischen Interessenkonstellationen entwickle. Dieser Kritik liegt ein falscher Begriff von Pragmatismus zugrunde. Jede Praxis, die trotz aller tagespolitischen Widrigkeiten nicht wenigstens ernsthaft versucht, vorgängig definierte Ziele zu erreichen, wird sich – auch wenn sie sich den Begriff des Pragmatismus zueignet – letztlich in der Praxelei, im muddling through, der Durchwurstelei verlieren. Nicht also die Modellarbeit als solche kann kritisiert werden, zu fragen ist vielmehr, ob ein Modell die Chance verbessert, den Selbstlauf der Tagespolitik im Sinne vorgängiger Ziele zu beeinflussen.
Nicht nur der aktuellen Regierungspolitik ist anzulasten, dass sie nach dem Ende des Kalten Krieges und der Blockkonfrontation noch nicht über eine außenpolitische Konzeption verfügt, die die historisch einmaligen Chancen zur Etablierung eines nachhaltigen und selbsttragenden globalen Friedensprozesses nutzt oder nutzen will. Auch die verschiedenen Ströme der Opposition verfügen neben ihrer durch Grundwerte definierten allgemeinen Zielsetzung und abgesehen von einzelnen Politiken und Theoremen noch nicht über ein einigermaßen schlüssiges Konzept, das der herrschenden Regierungspolitik als Alternative gegenübergestellt werden könnte. Das Konzept der ESG könnte es schaffen, die verschiedenen Diskussionsstränge, die sich in der Opposition entwickelt haben, zu einem gemeinsamen Diskurs zu bündeln. Es kann den Kristallisationspunkt einer neuen Ideenwelt bilden und eine kritische Diskussion stimulieren, an deren Ende eine umsetzbare Politik stünde. Diese grundsätzlich positive Einschätzung des ESG-Konzeptes sei vorangestellt, damit die nachfolgenden kritischen Anmerkungen als konstruktive Bezugnahme verstanden werden können, die einen Beitrag zur Weiterentwicklung leisten sollen. In diesem Sinne können kritische Punkte auch verstanden werden als Transformationsprobleme, die entstehen, wenn man, von der heutigen Konstruktion der außenpolitischen Wirklichkeit ausgehend, das neue Denk- und Handlungssystem durchsetzen will.
Die internationalen Verhältnisse zu Rechtsverhältnissen zu machen, die den Interessenkampf der Einzelstaaten kanalisieren und dem Recht des Stärkeren die Stärke des Rechts entgegensetzen – welcher friedliebende Mensch müsste diesem Plan nicht begeistert zustimmen. Eine Gemeinschaft von Staaten, die im Binnenverhältnis den Gewaltverzicht institutionell festgeschrieben haben und Gewalt höchstens noch als kollektiven Defensivakt gegen Angreifer von außen und als Polizeimaßnahme gegen Verletzungen des intern geltenden Kodex ausüben – eine Utopie, die selbst dann noch erstrebenswert und revolutionär bleibt, wenn das Phänomen der Waffe noch nicht vollständig aus der Welt verschwindet.
So eindrucksvoll die Suggestivkraft dieser Idee auch ist, so wirft sie aber einige grundsätzliche Fragen auf. Welche Motive und Interessen könnten die Nationalstaaten bewegen, in einem synchronen Prozess freiwilligen Machtverzicht zu leisten und sich einem System gemeinsamer Sicherheit anzuschließen? Und wenn es solche Motive gibt, warum sollten sie erst beim rechtlichen Regelungsmechanismus für vorhandene Konflikte ansetzen und nicht bereits konfliktpräventiv durch einen vernunftgeleiteten organisierten Interessenausgleich auf der materiellen Ebene? Wie soll zudem das neue Kollektiv sein Verhältnis zur Außenwelt so definieren, dass es nicht auf der Ebene der materiellen Interessen neue Konflikte schafft, bei deren Regelung es dann Partei und nicht Lösungsmechanismus ist? Und in welchem Verhältnis steht das ESG zu den existierenden europäischen und transatlantischen Institutionen, die für sich sicherheitspolitische Funktionen in Anspruch nehmen? Wie kann die „Verhältnismäßigkeit der Mittel“ die die nach innen gerichtete polizeiliche Ordnungsfunktion anstreben müsste, so gestaltet werden, dass daraus nicht eine Eskalationsdominanz im militärischen Sinne entsteht? Einige dieser Fragen sollen im folgenden weiterdiskutiert werden.
II.Universelle Verkehrsform und materieller Interessenanspruch
Der systemtheoretische, fast schon kybernetische Ansatz der Idee gemeinsamer Sicherheit geht davon aus, dass seine stimmige Logik allen internationalen Akteuren eine Beteiligung als vorteilhaft erscheinen lässt. Warum aber soll die Rechtsförmigkeit von Konfliktaustragung an sich als Vorteil begriffen werden? Kann sie für materiell schlechter gestellte Nationen den gleichen Vorteil bieten wie für die wohlhabenderen? Letzteren böte das Recht den Schutz ihres Reichtums, während es den Ärmeren keinen durchsetzbaren Rechtsanspruch auf materielle Entwicklung garantierte.
Die Übertragung von Idee und Praxis des innerstaatlichen Gewaltmonopols auf die internationale Ebene abstrahiert von der historischen Entstehungsgeschichte innergesellschaftlicher Zivilität. Die bürgerliche Gesellschaft mit ihrer Rechtsform des staatlichen Gewaltmonopols konnte nur auf der Basis der Gleichheit aller Partikularinteressen, die es zu regeln galt, entstehen. Sie selbst wurde nicht über Rechtsprozesse, sondern mit revolutionärer Gewalt durchgesetzt. Sie war das Ergebnis von Bürgerkriegen, die den Gleichheitsgrundsatz gegen den Feudalismus durchkämpften. Die Übertragung dieser Verlaufsform auf die internationale Ebene verbietet sich, da sie nichts anderes bedeuten könnte, als Krieg zur Durchsetzung der Zivilität zu führen, eine Denkfigur übrigens, die sich erschreckenderweise im Zusammenhang mit dem Bosnienkrieg immer wieder fand. Wenn aber das internationale Gewaltmonopol sich nicht so konstituieren kann wie das innere Rechtsverhältnis im Nationalstaat, dann sollte man erstens vorsichtig sein mit den rhetorischen Figuren, die beides gleichsetzen, wie es in der aktuellen politischen Diskussion immer wieder geschieht.
Zweitens ist man wieder auf die Frage der Motivation verwiesen, die eine ärmere Region dazu bewegen könnte, mit einer reicheren einen prinzipiellen Rechtsfrieden einzugehen. Die bürgerlichen Revolutionen konnten dort gelingen, wo die Gleichheit der Partikularinteressen nicht nur reine Fiktion war, sondern ein hinreichend breiter Teil der Gesellschaft aktiv und mit Gewinnaussicht am wirtschaftlichen Austausch partizipierte. Das dürfte ja wohl der Grund dafür sein, dass in osteuropäischen und den GUS-Nachfolgestaaten die Demokratisierung so schwer vorankommt. Für die neuen Demokratien gilt wie für die alten westlichen: die Rechtsförmigkeit gesellschaftlicher Austauschprozesse garantiert eine Verkehrsform, die, was die materiellen Interessen angeht, neutral, d.h. aber auch sozial indifferent bleibt. Unter dem Prinzip der universellen Geltung der Partikularinteressen ist alles gleichermaßen legitim, so es sich nur an den Rechtsrahmen hält, das Interesse an Ausbeutung ebenso wie das an Emanzipation. Solange aber davon ausgegangen werden kann – und das entspricht dem reinen Typus des Liberalismus -, dass sich die materiell stärkeren Interessen auf dem freien und durch formale Rechtsnormen geschützten Markt durchsetzen, wird das Rechtssystem faktisch zu einer zivilen Garantiemacht der Wohlhabenden. Erst die Garantie sozialstaatlicher Standards macht die Rechtsförmigkeit des gesellschaftlichen Austauschs auch für weniger Wohlhabende attraktiv. Dieser Gedanke muss nun auf die internationale Ebene übertragen werden.
Das Motiv einer materiell rückständigen Nation, sich einem System gemeinsamer Sicherheit anzuschließen, kann doch nur in der Hoffnung liegen, dass dieses die eigenen Lebenschancen eher zu verbessern verspricht als die Perspektive, jenseits aller bürgerlichen Rechtsnormen sein Glück in Akten der Piraterie zu suchen. Dies kann durch die Aufnahme von sozialen Klauseln in das konstitutive Recht geschehen als auch durch eine ergänzende Politik materiellen Interessenausgleichs. Letztlich wird sich dieser Interessenausgleich als das entscheidende Kriterium dafür erweisen, ob der friedliche Weg als der attraktivere erscheint. Friedenspolitik muss sich deshalb, auch wenn sie letztlich in die höchste Form des Friedens, den Rechtsfrieden einmünden will, zunächst um die Konfliktminimierung auf der Ebene materieller Lebenschancen kümmern. Es gibt keinen langfristigen Rechtsfrieden ohne einen nachhaltigen sozialen Frieden. Ein Gewaltmonopol wird nur dann eine freiwillig akzeptierte Geltung erlangen, wenn es nicht ungerechte soziale Verhältnisse ohne erkennbare Verbesserungsperspektive festschreibt. Deshalb soll im Folgenden der Blick darauf gerichtet werden, welche Strategien materiellen Interessenausgleichs vorgängig einzuschlagen wären, um der Bildung eines internationalen Rechtssystems eine größere Chance zu verleihen.
III. ökologisch-solidarische Strukturpolitik
Die Lebenschancen aller Völker unter Beachtung der ökologischen Belastbarkeit des Globus auf möglichst hohem Niveau aneinander angleichen – so könnte man das umfassende Ziel globaler Entwicklung definieren. So auch müsste das Ziel einer Friedenspolitik lauten, die die ökonomischen, sozialen und ökologischen Ursachen bewaffneter Konflikte beseitigen möchte. Hier schon zeigt sich, dass das Interesse an einem formalen Rechtsfrieden und einem materiellen Frieden heute noch weit auseinanderklaffen. Gerade führende Industriestaaten, die Gewalt im gegenseitigen Verhältnis abgeschafft haben, schaffen und zementieren in ihrer Gesamtheit weltweit Strukturen, die dem Ziel des sozialen Friedens diametral entgegenstehen.
Die Anforderungen an Friedenspolitik im Sinne eines erweiterten Sicherheitsbegriffs müssen deshalb neu definiert, die Chancen, die die Veränderungen des Jahres 1989 brachten, einbezogen werden. Eine Friedenspolitik, die Alternativen entwickeln will, muss sich in den vier zentralen Feldern bewegen, die heute die Gesamtheit der internationalen Politik ausmachen:
– Umwelt- und Klimapolitik
– Handels- und Investitionspolitik
– Finanz- und Währungspolitik
– Sicherheits- und Militärpolitik
Dies meint keinen Universaltitätsanspruch. Ein politisches „Weltsystem“ entwerfen zu wollen, wäre vermessen. Doch die wachsende Integration der Weltwirtschaft führt dazu, dass die Grenzen zwischen den unterschiedlichen Feldern internationaler Politik immer stärker verschwimmen und an den Schnittmengen neue Schwerpunkte außenpolitischen Handelns entstehen, die ein erweitertes konzeptionelles Verständnis von Außenpolitik erfordern. Das gilt auch für die Binnenbeziehungen in einer ESG.
In der offiziellen Politik stoßen wir auf das Paradox, dass der nicht mehr zu leugnenden globalen Problementwicklung nur eine Scheinglobalität der Lösungsversuche gegenübersteht. Unter Globalisierung wird in erster Linie ein erweiterter Horizont für die traditionelle nationale Interessenorientierung verstanden. Statt regionale und globale Regulation in Schlüsselbereichen der internationalen Politik zu betreiben, wird im neoliberalen Sinne dereguliert, überhöht mit dem ideologischen Bekenntnis, das Kräftespiel der Partikularinteressen diene einem globalen Gemeinwohl, garniert mit internationalen Konferenzen, wo die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit immer grotesker wird, und flankiert mit militärgestützten Ordnungsversuchen, die dem ungeregelten Liberalismus einen externen Halt geben zu geben versprechen.
Friedenspolitik darf sich nicht darauf beschränken, die Diskrepanzen in der offiziellen Politik anzuklagen – wiewohl dies in viel gezielterer Form nötig ist -, sondern muss den Diskurs zu verstärken suchen, der Alternativen entwickeln und durchsetzen will. Diese müssen sich sowohl immanent, d.h. im Rahmen der objektiv ablaufenden Prozesse verorten, als auch über die Sparten der offiziellen Politik hinausgehend, interdisziplinäre Fragen einbeziehen.
Die Globalisierung der Weltwirtschaft korrespondiert mit einem Prozess der Globalisierung der Probleme und Risiken. Der Dynamisierung sogenannter „internationaler Arbeitsteilung“ in den Produktionstrukturen international agierender Unternehmen, des Welthandels, Weltverkehrs, der elektronischen Kommunikation und eines globalen, von realwirtschaftlichen Prozessen weitgehend entkoppelten Finanzmarktes, entspricht eine wachsende Interdependenz der damit verbundenen Probleme der Umweltzerstörung, ruinöser Standortkonkurrenz, Massenarmut, Wanderungsbewegungen, sozialer Desintegration, gewaltsamer Konfliktaustragung, regionalen Wettrüstens, unkontrollierten Nuklearpotentials und internationaler Banden- und Wirtschaftskriminalität. Die Themenfelder der Außen- und Umweltpolitik, der Außenwirtschafts-, Finanz- und Sicherheitspolitik bilden vor diesem Hintergrund immer größere Schnittfelder, zugleich klafft eine wachsende Schere zwischen dieser Globalisierung und den politischen Handlungsmöglichkeiten der Nationalstaaten. Die Gefahr wächst, dass eine verselbständigte Weltökonomie die wirtschaftliche, soziale und ökologische Regelungskompetenz der Staaten aushebelt. Die Trends der globalen Entwicklung verweisen auf vielfältige gesellschaftliche Regelungsdefizite denen bislang weder Umwelt-, noch Wirtschafts-, noch Sicherheitspolitik in Theorie und Praxis gerecht werden konnten.
Das enorme Konfliktpotential im internationalen System, die notwendigen ökologischen, ökonomischen und sozialen Korrekturen der Weltentwicklung erfordern eine neue internationale Strukturpolitik, die die Interessen an einer nachhaltigen Entwicklung mit den Aufgaben einer internationalen Krisenprävention konzeptionell verbindet und sich dabei nicht um den Konflikt drückt, der zwischen konkreten ökonomischen Interessen und bewussten Wertentscheidungen für das Primat langfristiger Überlebensinteressen sowie sozialer Gleichheit und Gerechtigkeit in und zwischen den Nationalstaaten besteht. Auf der politischen Tagesordnung steht sozusagen die Entwicklung eines erweiterten, entmilitarisierten Sicherheitsbegriffs, der an der Schaffung von positiven gesellschaftlichen Bedingungen für „nachhaltigen“ Frieden orientiert ist.
Diese Einschätzung wird in den Grundlinien heute von den ExpertInnen der verschiedensten Sparten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik geteilt. Die politische Auseinandersetzung um Lösungswege bleibt dagegen noch recht abstrakt. Die politische Zuspitzung der Diskussion sollte auf die Wechselwirkung zwischen der Förderung nachhaltiger Entwicklung, Konfliktprävention und Konfliktbearbeitung liegen.
Die Debatte um eine sozial- und umweltverträgliche und damit konfliktpräventive Gestaltung der internationalen Wirtschaft hat sich mit der Schaffung der neuen Welthandelsorganisation (WTO), den Forderungen der G-7-Gruppe nach einer Neuordnung der internationalen Finanzinstitutionen, den Verpflichtungen des Weltsozialgipfels und der Vorlage des Global Governance Report 1995 belebt. Heute stehen insbesondere die Fragen auf der Tagesordnung
– wie die Verankerung verbindlicher sozialer Mindeststandards nach dem Muster der elementaren Sozialklauseln der ILO negative soziale Auswirkungen des internationalen Handels und das gezielte Anheizen einer zerstörerischen Standortkonkurrenz durch internationale Unternehmen eindämmen kann.
– wie analog Umweltstandards internationales „Öko-Dumping“ verhindern können und internationales Ordnungsrecht gegen den exzessiven Verbrauch nicht regenerierbarer Ressourcen geschaffen werden kann
– wie für internationalen Handel und Investitionen durch ein globales Wettbewerbsrecht und einen neuen Investitionskodex verbindliche Regelungen für unternehmerische Tätigkeit geschaffen werden können
– wie eine Stärkung des UN-Waffenregisters durchgeführt werden kann, so dass regelmäßig Waffengeschäfte und entsprechender Technologietransfer kontrolliert und aktuelle Informationen darüber veröffentlicht werden
– wie internationale Besteuerung geschaffen bzw. durchgeführt werden kann, etwa auf internationale Finanztransaktionen (Tobin-Steuer) oder als Unternehmensteuer für transnationale Konzerne und mit einem Konzept zur Lösung der Schuldenkrise verbunden werden kann
– wie eine Reform der internationalen Finanzinstitutionen zu weltwirtschaftlichen Steuerungsinstrumenten im institutionellen Rahmen der Vereinten Nationen und eine internationale Banken-Aufsicht durchgesetzt werden können.
Insgesamt skizzieren diese Themen auch erste Konturen einer globalen Strukturpolitik, die im unmittelbaren Zusammenhang mit den Sicherheitsbedürfnissen jetziger und künftiger Generationen zu sehen ist. Sowohl für die präventive Friedensarbeit, die akute Konfliktbearbeitung als auch die Konfliktfolgenbearbeitung haben diese Bereiche der Strukturpolitik eine wichtige Bedeutung. Funktionierende positive Strukturhilfen oder Sanktionen ebenso wie negative Sanktionen oder Embargomaßnahmen im Handels- wie Finanzbereich bedürfen funktionierender globaler ordnungspolitischer Instrumente. Sicherheitspolitik ist heute ohne eine ökonomische und insbesondere auch ohne eine finanzpolitische Dimension nicht mehr denkbar. Es geht politisch gegenwärtig darum, diese Dimension möglichst konkret in einem Dialog zwischen Finanz- und WirtschaftsexpertInnen und der Friedensforschung herauszuarbeiten und entsprechende Handlungsstrategien zu entwickeln.
Diese Überlegungen können auch unter den Fragestellungen einer neuen Sicherheitspolitik von Bedeutung sein. Zugespitzt: die meisten der absehbaren militärisch eskalationsfähigen Konflikte haben ein ökonomisch-ökologisch-soziales Bedingungsgefüge. Strukturpolitik wäre konfliktpräventiv. Umgekehrt können bei bereits eskalierten Konflikten strukturpolitische Überlegungen und wirtschaftspolitische Maßnahmen pazifierend wirken. Voraussetzung aber wäre ein Begreifen dieses Zusammenhangs durch die offizielle Politik und die Aufgabe der überkommenen Spartentrennung von Sicherheits-, Außen -, Außenwirtschafts- und internationaler Finanzpolitik.
Zu den angesprochenen zentralen Politikbereichen sind in den letzten Jahren von verschiedenen UN-Organisationen, von zahlreichen NROs und aus der Wissenschaft interessante Reformvorstellungen und neue Konzepte entwickelt worden. Bereits seit Mitte der achtziger Jahre hat sich die Diskussion über den Zusammenhang von Entwicklung und Ökologie entwickelt. Sie wurde u.a. in einem Konzept der Grünen über den Weg zu einer ökologisch-solidarischen Welt zusammengefasst. Friedenspolitik müsste als Katalysator für eine Bilanzierung und Verdichtung dieser vielfältigen Debatten wirken. Die Problemstellungen globaler ökologischer, ökonomischer und sozialer Regulation müssen mit denen eines erweiterten Sicherheits- und Friedensbegriffes zusammengebracht werden, ohne gleich umstandslos einer zentralistischen „Weltinnenpolitik“ das Wort zu reden.
IV. Die Institutionen für Sicherheit und Zusammenarbeit
Nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes hatte es die historisch einmalige Gelegenheit zu einer substanziellen Abrüstung gegeben. Sie wurde aus nationalstaatlichen Egoismen verschenkt. Die Rüstungskontrollverträge der Übergangszeit (KSE, START) wurde nicht weiterentwickelt und sind heute der internationalen Sicherheitslage nicht mehr angemessen. Anstatt des zunächst erhofften Friedens sind viele innergesellschaftliche Konflikte in zum Teil grausame Bürgerkriege umgeschlagen. Der internationalen Staatengemeinschaft fehlen sowohl auf globaler wie auf regionaler Ebene die Mittel, um die Konflikte adäquat zu bearbeiten und einer Lösung zuzuführen. Konfliktprävention und Konfliktmoderation besitzen noch keine handlungsmächtigen zivilen Organisationen.
Beunruhigenderweise ist die sicherheitspolitische Diskussion inzwischen hinter den Stand der achtziger Jahre zurückgefallen. Es wird nicht einmal mehr über defensive Militärstrategien nachgedacht, im Gegenteil, die NATO hat ihren Aufgabenbereich erweitert. Während sie sich früher als Verteidigungsbündnis definierte, ist sie jetzt eine Interventionsbündnis, das auf diffuse Risiken reagieren soll. Sie ist nicht bereit, die Atomstrategie und die Option auf einen nuklearen Ersteinsatz aufzugeben. Die angestrebte Erweiterung nach Osten produziert einen weiteren destabilisierenden Unsicherheitsfaktor für eine gesamteuropäische Sicherheitsstruktur. Die WEU ist nach Jahren des Dahindämmerns wiederbelebt worden und entzivilisiert als zukünftiger militärischer Arm die Europäische Union. Die rein militärischen Instrumente, die jetzt entwickelt werden, sind nicht in der Lage auf die Vielzahl der kleinen Kriege friedenspolitisch zu reagieren, sondern primär daran orientiert, „Stabilitätsinteressen“ des Nordens durchzusetzen. Das Geflecht der Institutionen dient dazu, flexible Einsatzmöglichkeiten zu schaffen. Das Problem sind heute nicht mehr militärische Alleingänge Deutschlands, sondern eine neue Form des militärischen Multilateralismus. Durch den Aufbau neuer militärischer Apparate und Strukturen fehlen aber die notwendigen Ressourcen für den Aufbau von zivilen Konfliktmoderierungs- und Lösungsinstrumenten.
Als gravierendes Problem stellt sich deshalb die Frage nach dem Verhältnis der bestehenden sicherheits- und verteidigungspolitischen Institutionen zum angestrebten ESG. Es ist nicht einzusehen, warum eine völlig neue Organisation geschaffen werden soll, wenn zumindest eine der bestehenden, nämlich die OSZE, wesentliche Merkmale dessen aufweist, was die Konstrukteure der ESG als unabdingbar für ein kollektives Sicherheitssystem definieren. Die OSZE hat nicht nur den Vorzug sicherheitspolitische, ökonomische und menschenrechtlich-demokratische Aspekte systematisch und institutionell zu behandeln; sie weist darüber den unschätzbaren Vorteil auf, schon existent zu sein. Sichtbar ist zwar eine operationale Schwäche und der mangelnde Wille zahlreicher Mitgliederstaaten, diese Organisation tatsächlich in ihrer Handlungsfähigkeit zu stärken. Die Einsicht in die Notwendigkeit eines ESG könnte aber dazu beitragen, einen Schub zur Kräftigung der OSZE zu geben, damit diese Institution endlich die Funktionen ausfüllen kann, die im Rahmen einer umfassenden Sicherheitspartnerschaft und zur Organisierung eines nachhaltigen Rechtsfriedens notwendig sind.
Während das Verhältnis von ESG und OSZE sich lösen ließe durch die In-Eins-Setzung, wirft die Existenz der NATO gravierendere Fragen auf. Von ihrer gesamten Konstruktion her ist und bleibt die NATO ein Verteidigungsbündnis von Staaten, das per Definitionem ein anderes Bündnis voraussetzt oder seine Bildung provoziert. Die NATO lebt von der Grenzziehung und nicht davon, sich als System über ehemalige oder potentielle Feindmächte zu wölben, um deren internationale Interaktion in die rechtliche Bahn zu lenken. Die Tatsache, dass nach der Auflösung des Warschauer Vertragssystems die NATO nicht ebenfalls zur Disposition gestellt wurde, erweist sich nun als hinderlich bei der Ausbildung eines kollektiven Sicherheitssystems. Die NATO ist von einer solchen realen Gewalt, dass jeder akademisch-konzeptionell daherkommende Gedanke, der ihre Nichtexistenz wünscht, weit an den Realitäten vorbeigeht. Die NATO wird realerweise nur in dem Maße an Einfluss verlieren, als es einem neuen System praktisch gelingt, alte Funktionen der NATO, die vielleicht noch notwendig sind, zu übernehmen und gleichzeitig die neuen Funktionen, die die NATO sich anmaßt oder die ihr zugeschrieben werden, mindestens genauso gut zu erfüllen.
Diese Einschätzung macht aber sichtbar, dass NATO und ESG/OSZE zwei Ansätze sind, die sich konzeptionell und deshalb auch praktisch ausschließen. Wer ein kollektives Sicherheitssystem durchsetzen möchte, muss abrücken von der Idee eines Bündnissystems einzelner Nationalstaaten. Es mag schwierig sein, der NATO politisches und operatives Terrain, das sie besetzt hat, streitig zu machen. Möglich aber ist es auf jeden Fall, die Ausbreitung des Operationsgebietes des NATO zu verhindern. In diesem Zusammenhang sind zwei reale Tendenzen und Entwicklungen als äußerst problematisch zu betrachten. Die Osterweiterung der NATO steht der Einrichtung eines kollektiven Sicherheitssystems, das außer den osteuropäischen Staaten insbesondere auch Russland und die anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion umfasst, diametral entgegen. Jede Ausdehnung nach Osten wird an der grundsätzlichen Tatsache, dass ein Riss mitten durch Europa geht, nichts ändern. Die Front wird nur verschoben. Der Gedanke, dass die NATO bis nach Moskau ausgeweitet werden und damit Russland integrieren könnte, ist auf der einen Seite faszinierend, weil damit die NATO ihren ursprünglichen Charakter verlöre und quasi das militärische Gerüst einer ESG abgeben könnte. Aber auch wenn vor knapp drei Jahren die Clinton-Administration kurz mit diesem Gedanken gespielt hat, so scheint er doch völlig abwegig zu sein. Eine Osterweiterung der NATO wird faktisch so ablaufen, dass eine Anzahl von Staaten aufgenommen wird, während eine andere Gruppe draußen bleiben muss. Diese könnte sich gezwungen sehen, sich um Russland als den Kern eines neuen östlichen Sicherheitssystems zu scharen. Zumindest würde Russland sich eingeladen fühlen, die Nicht-NATO-Staaten als sein besonderes Einflussgebiet zu betrachten. Damit würde die Blockkonfrontation wieder neu begründet und höchstwahrscheinlich einmünden in einen neuen Rüstungswettlauf. Die Chance um die Konstituierung eines gemeinsamen Dachs dieser unterschiedlichen politischen Sphären wäre auf lange Zeit verspielt. Wer ein Interesse an der Bildung eines kollektiven Sicherheitssystems hat muss deshalb schon aus dieser Perspektive energisch der Osterweiterung der NATO widersprechen.
Ein zweites gravierenden Problem ist die Tatsache, dass die NATO sich mehr und mehr Aufgaben angeeignet hat, die eigentlich die UNO hätte erfüllen müssen. Am brisantesten ist dabei der Einsatz in Ex-Jugoslawien. Dort wurde von den westlichen Staaten jahrelang eine fatale Politik betrieben, die aus der Konkurrenz der einzelstaatlichen Machtambitionen im Balkan bestand. Die Nichtexistenz eines Willens zu gemeinsamem Handeln mündete in die Unmöglichkeit und Unfähigkeit, eine gemeinsame Handlungsperspektive für die UNO zu entwickeln, die dieser einzigen nicht bündnisgebundenen Institution tatsächliche Durchsetzungsmöglichkeiten im Konfliktgebiet gegeben hätte. Als das Kind in den Brunnen gefallen war allerdings, sah man sich plötzlich zu einer durchgreifenden Haltung in der Lage. Diese bestand nun darin, das Staatenbündnis NATO als Subunternehmerin der UNO so zu stärken, dass ihre eigentliche Auftraggeberin zur reinen Legitimationsinstanz der NATO-Politik verkommen ist. In der Tat waren die Entwicklungen in Ex-Jugoslawien so grauenhaft zugespitzt, dass eine Diskussion über ein westliches Eingreifen sich weithin nur noch um die Frage der Effizienz und nicht mehr die der Legitimation im Sinne einer langfristigen sicherheitspolitischen Strategie drehte. Es darf vermutet werden, dass diese Entwicklung nicht zufällig so eingetreten ist. Mit der Übertragung der Ordnungsfunktion an die NATO als den Kernbestandteil von IFOR wurde ein sicherheitspolitisches Modell eingeführt, das festzuschreiben auch für zukünftige Konflikte so mancher Staat ein Interesse haben dürfte. In diesem Zusammenhang ist die Mandatsübergabe von der UNO an die NATO im Rahmen von IFOR als friedenspolitischer Super-GAU zu betrachten. Es ist davon auszugehen, dass die NATO ihren Job gut machen wird. Dies ist zu begrüßen im Sinne der betroffenen Menschen, die zurecht fordern und eine Hoffnung darin finden, dass dem Morden durch das Eingreifen einer stärkeren Kraft ein Ende gemacht wird. Auf der anderen Seite aber ist diese stärkere Macht so konstituiert, dass damit ein längerfristiges Ordnungsmodell, was das Aufkeimen neuer Regionalkonflikte verhindern könnte, nicht verbunden ist. Es hat im Gegenteil den Konstruktionsfehler, als Apparat einer Hegemonialmacht zu fungieren und nicht als Ordnungsfaktor eines gemeinsamen Rechtssystems.
Wenn Friedenspolitik nicht den Mut hat, genau dann mit Alternativen zum herrschenden militärischen Diskurs einzugreifen, wenn ein militärisches Eingreifen geplant wird, sondern sich darauf beschränkt, in Friedenszeiten Konzepte zu entwerfen, die in Konfliktzeiten sofort wieder negiert werden, dann wird sie akademische Veranstaltung bleiben. Friedenspolitik muss den Mut haben, seine eigenen institutionellen Optionen genau dann einzubringen, wenn der scheinbare Sachzwang nach einer Perpetuierung der militärischen Traditionen ruft. Dies hätte geschehen können zumindest in Form eines Junktims bei den entsprechenden Debatten im Deutschen Bundestag. Wenn man schon in realistischer Einschätzung dessen, dass bestimmte friedenspolitisch wünschbare Institutionen und ihre Machtapparate noch nicht vorhanden sind, eine Zustimmung zu den bestehenden in Betracht zog, dann hätte man dem zumindest die Forderung zur Seite stellen müssen, dass dieser Konfliktfall die letzte Aufforderung dafür darstellt, alternative Strukturen zu entwickeln. Praktisch hätte dies bedeutet, die Opposition stimmt dem Einsatz der Bundeswehr nur unter der Bedingung zu, dass die Regierung sich sofort daran begibt, im Sinne der Herbeiführung einer ESG die OSZE zu stärken, der NATO die Kompetenzen zu beschneiden, ihre Osterweiterung nicht weiter zu betreiben, militärische Potenzen abzubauen und eine zivile Ordnungsmacht zu bilden, die im Rahmen einer neuen Friedensordnung quasi als Polizeiorgan fungieren könnte.
Leider aber hat sich herausgestellt, dass Teile der Opposition nicht nur aufgrund des beschriebenen Sachzwangs dann der traditionell militärischen Lösung zustimmten. Schlimmer noch, einige Kreise favorisieren jetzt sogar die NATO als den Kern eines weltweit wirkenden pazifierenden Systems. Der Einschätzung folgend, dass die OSZE ihren Machtanspruch, der 1989 formuliert hätte werden müssen, verschlafen hat, wird nun in Anpassung an die realen Tendenzen der NATO eine zivilisierende Rolle zugeschrieben. Sozialpsychologisch handelt es sich dabei um die „Identifikation mit dem Aggressor“. Wenn man schon nicht stark genug ist, die Institution, die eine friedenspolitische Zukunft zunichtemacht zurückzudrängen, dann biedert man sich sofort so stark an, dass man die Differenzen und damit auch die eigene Macht- und Rückgratlosigkeit nicht mehr wahrnehmen muss.
Die neue NATO-Apologie hat einen weiteren Nachgeschmack, der noch fader ist. In den Debatten um den Bosnieneinsatz fand sich sehr oft die Denkfigur, dass man das Militär brauche, nicht um ein internationales Recht durchzusetzen, sondern um Werte und Normen von Zivilität durchzukämpfen. So mancher meinte, das Ziel der multikulturellen Gesellschaft, das in Deutschland der progressive Gegenentwurf zur Ausgrenzungspolitik der Bundesregierung ist, im ehemaligen Jugoslawien und in Bosnien-Herzegowina aber nur von Teilen der Bevölkerung aktiv getragen wird, ließe sich quasi mit Überheblichkeit des westlichen Denkens zum Ausdruck bringen Bei aller Selbstgewissheit, die bessere Normenwelt gegenüber allen anderen Kulturen zu haben, sollte sich der Westen dennoch klar machen, dass dieses subjektive Empfinden in den anderen Kulturen genauso vorhanden ist und dort ebenso zu der Einschätzung führen könnte, dass zu deren Durchsetzung auch kriegerische Mittel legitim seien. Das Gerede vom Heiligen Krieg mag ein Beispiel dafür sein.
V. Der politische Wille als Transformationsproblem
Nicht nur den heutigen Nationalstaaten kann unterstellt werden, dass sie sich auf eine ESG nicht ohne weiteres werden einlassen wollen. Auch Träger nichtstaatlicher Friedenspolitik finden in diesem Konzept nicht unbedingt ihre Hoffnungen formuliert. Denn immerhin kommt eine ESG nicht ohne Waffen und eine prinzipielle Einsatzdoktrin aus. Genau dies aber aus der Welt schaffen zu wollen, motiviert zahlreiche Pazifistinnen und Pazifisten, Menschen, die im Oppositionszusammenhang wirken und gewonnen werden müssen, wenn eine Gegenmacht zur aktuellen Regierungspolitik entwickelt werden soll.
Ob Gesinnungspazifisten, die im Phänomen der Waffe unabhängig von Doktrin und Entwicklungsrichtung an sich schon das Übel sehen, für eine Politik zu gewinnen sind, die über die individuelle Verweigerungshaltung hinausgeht und durch die Einführung kollektiver Sicherheit dem traditionellen Militär die Handlungsräume verstellt und damit die Legitimation entzieht, ist fraglich. Vertreter des politischen Pazifismus aber, die nach real durchsetzbaren Strategien der Deeskalation suchen, die nicht nur das eigene Verhalten betreffen, sind offen. Für sie aber gibt es eine politische Kalkulation, die aufgehen muss. Sie kann illustriert werden mit dem sogenannten Gefangenendilemma: die Sicherheit des Gefängnisses ist die schlechtere Situation im Vergleich mit der Freiheit, aber die bessere gegenüber der Perspektive, beim Fluchtversuch getötet zu werden. Die Flucht kann nur bei Minimierung des Fluchtrisikos versucht werden.
Das bedeutet übertragen auf die sicherheitspolitische Debatte: Das „Gefängnis“ ist die eigene pazifistische Vorstellungswelt; ein „Gefängnis“ deshalb, weil der Frieden nur im eigenen Kopf existent ist, wie jede Gefängnisphantasie überfrachtet auch mit illusionären Hoffnungen. Die „Freiheit“ ist die Realisierung eines nachhaltigen von den Einzelstaaten getragenen Friedensprozesses, mit all seinen unvollkommenen Übergangsformen. Das „Risiko“ besteht darin, dass der Weg aus der pazifistischen Vorstellungswelt hin zum ESG faktisch im Übergang steckenbleibt, praktisch in der Stärkung und Erweiterung der NATO. Wenn dieses Risiko zu groß ist, wird die Bereitschaft, die eigenen Lieblingsvorstellungen von der friedlichen Welt zugunsten der Perspektive kollektiver Sicherheit aufzugeben, gering sein.
Eine solche Befürchtung ist nicht unbegründet. So haben prominente Grüne bereits gefordert, die NATO müsse der bewaffnete Arm der OSZE werden und sich dabei auf das Konzept der ESG berufen. Das Programm „Partnerschaft für den Frieden“ wird manchmal als Weg zur kollektiven Sicherheit dargestellt, läuft im Moment aber faktisch auf die politische Absicherung der NATO-Osterweiterung hinaus. Das Bundesverfassungsgericht hat fälschlicherweise die NATO ähnlich der UNO als kollektives Sicherheits- (statt Verteidigungs-)System gekennzeichnet. Die Bundesregierung, ein Großteil der SPD, die NATO bemühen sich, das westliche Militärbündnis als den alternativlosen global agierenden Peacemaker in den Vordergrund zu rücken und Befürchtungen und Ablehnung durch andere Staaten, insbesondere durch Russland, als albern hinzustellen.
Diese Tendenzen wirken einer breiten oppositionellen Willensbildung zugunsten der ESG entgegen. Bewaffnete Sicherheitsapparate werden von politischen Pazifisten nur akzeptiert werden können, wenn sie im Sinne des ESG-Konzeptes funktionieren. Sollte jedoch der Verdacht genährt werden, die ESG-Diskussion führe zu einer Legitimierung bestehender militärischer Strukturen, einschließlich ihrer Modernisierung, so wird es eine Unterstützung nicht geben. Dann wird man verharren bei der zweitbesten Lösung, dem individuellen Abschwören an alles Gewalttätige und der Forderung an die Bundespolitik, sich machtpolitisch selbst zu beschränken, zu entmilitarisieren und zu zivilisieren ohne Rücksicht darauf, wie sich das auf das internationale Institutionengefüge auswirkt. Der Weg von der zweitbesten zur besseren Lösung wird dann und nur dann frei werden, wenn man nicht Gefahr läuft, sich faktisch die schlechteste einzuhandeln.