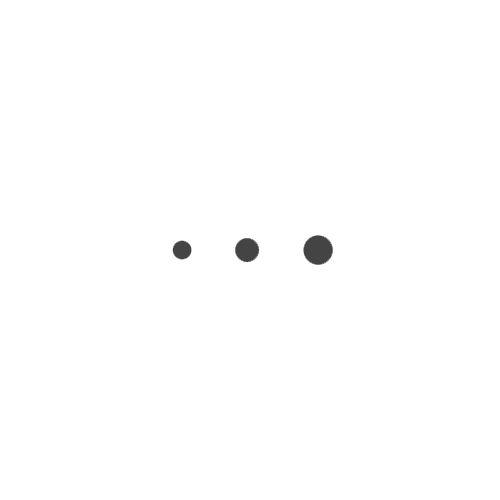(Zu den desaströsen Ergebnissen von Bündnis 90/Die Grünen bei den Landtagswahlen von Hessen und Niedersachsen am 27. Januar 2008 schrieb ich am 31. Januar 2008 eine kritische Analyse, die am 14. Februar 2008 im „Rheinischen Merkur“ und im „Forschungsjournal Neue soziale Bewegungen“, Ausgabe 2, im Juni 2008 abgedruckt wurde; hier leicht redigiert)
Die Grünen haben so wenige Stimmen bekommen, weil andere so viele erhalten haben. So lautet – kurz gefasst – die „Wahlanalyse“ der Ein-Mann-Spitze in Hessen. Die SPD sei durch die Decke gegangen, und die Linke, nun ja, die Linke sei jetzt auch am Start. Die Schlichtheit dieser Tautologie – die Grünen verlieren, weil die anderen gewinnen – ist ebenso verblüffend wie die wahnhaft dahin gelächelte Erleuchtung des Bundesvorstandes, die Niederlage eröffne neue strategische Optionen. Nun müssen Spitzenfunktionäre, wie ich selbst weiß, manchmal nach außen beschwichtigen. Verzeihlich ist das dann und nur dann, wenn nach innen die notwendige Reflexion stattfindet. Aber tut sie das?
In Hessen ist mehr passiert, als dass für das Alpha-Männchen von einst kein adäquater Ersatz gefunden wurde. Das Modell, per Rhetorik und Popstar-Gebaren Unentschlossene herumzukriegen und über strategische Fehlentscheidungen hinweg zu spielen, ist ausgelaufen. Der Versuch, statt alternative Politik alternierendes Personal anzubieten, hat sich erledigt. Die selbstgefällige Attitüde, mit dem Anspielen linksbürgerlicher Kulturmuster die Großstadt-Szene abgreifen zu können, hat sich demontiert. Die Agenten von Ökologie und Verbraucherschutz fuhrwerkten an dem vorbei, was die Seite der Globalisierungsverlierer bedrückt. Das Selbstverständnis der Bundestagsfraktion, die intelligenteste von drei Oppositionspolitiken zu betreiben, mag anheimelnd sein, aber wie viele Wähler verfügen schon über einen IQ von 140. Gemeinsam mit (CSU-Gesundheitsminister) Seehofer die Dicken zu bekämpfen, in der Person Koch (CDU-Chef Hessen) die Doofen und während einer zweijährigen Hochkonjunktur des ur-grünen Themas Klimawandel gar nicht vorzukommen, ist merkwürdig für eine Partei, die den Geltungsanspruch erhebt, dritte Kraft, Alternative und strategischer Partner der SPD sein zu wollen. Das Hauptproblem liegt m.E. aber darin, dass der grüne Grundwert „sozial“ bis zur Unkenntlichkeit verblasst ist. Es rächen sich heute – und das war voraussehbar – strategische Fehlentscheidungen von vor 10-15 Jahren: nämlich die Partei von einer sozial-ökologischen in eine ökologische Bürgerrechtspartei umzumodeln.
Solange ich für die Gesamtentwicklung der Partei Verantwortung trug – vom Ende der 1980er bis Mitte der 1990er Jahre – war mir klar, und ich versuchte dies auch als Linie der Parteiführung zu implementieren: eine Ausweitung der PDS nach Westen muss unbedingt verhindert werden! Das war eine strategische Entscheidung. Ein politischer Wille. Er motivierte sich aus der Einschätzung, dass die Westausdehnung der PDS den Grünen die Bedeutung nehmen würde. Inhaltlich, weil die Linke in der sozialen Frage entschiedener auftreten würde; strategisch, weil sie die von der SPD enttäuschten Protestwähler auffangen würde; und kulturell, weil sie das interessantere Momentum in der deutschen Politik darstellen würde. Diese PDS-Eindämmungspolitik war damals effektiv, wie Gysi selbst mir bestätigte. Und sie wirkte auch noch bis Ende der 1990er Jahre fort, obwohl ihre Voraussetzungen in der grünen Politik bereits erodierten. Mit den Wahlerfolgen der „Linken“ nun ist nicht nur der GAU für die Grünen eingetreten, sondern der Super-GAU. Der Super-GAU – zur Erinnerung – ist der Größte Anzunehmende Unfall, der nicht mehr beherrschbar, der irreversibel ist.
Das Feld der epochalen Niederlage der Grünen ist die soziale Frage, das Kernthema der „Linken“. Die Niederlage auf die Demagogie eines Lafontaine oder den Talkshow-Witz eines Gysi zu schieben, wäre zu billig. Es sind die Grünen selbst, die sich ihre Basis abgegraben haben. Dazu ein kleiner Abriss der Karriere der sozialen Frage in der Partei:
Im Gründungsprozess 1980 war heftig umstritten, ob das Soziale ein formulierter und fixierter Grundwert der Partei werden solle. Unumstritten war das Ökologische als Hauptmotiv für die Gründung und das Alleinstellungsmerkmal in der Parteienlandschaft. Aber um das Ökologische gesellschaftspolitisch einzubetten, musste über die Vorstellung von Gesellschaft gerungen werden. Anfangs war völlig offen, ob die Grünen ein emanzipatorisches oder ein Blut- und Boden-Projekt würden. Die Grundsatzentscheidung zum §218 führte zum Austritt der Konservativen. Die Grundsatzentscheidung für den sozialen Grundwert führte dazu, dass ein Großteil der linken Gruppen der 1970er Jahre sich in den Parteigründungsprozess integrierte. Die Grünen besetzten den links von der SPD vakanten Platz im Parteienspektrum, ohne eine traditionelle Linkspartei zu sein. Es ging eher um kulturelle Avantgarde, wir waren Vordenker und Experimentierlabor der Gesellschaft. Die dem eigenen Selbstverständnis nach „Linken“ unterzogen sich – wenn auch oft mühsam und sträubend – einem gemeinsamen Lernprozess mit wertkonservativen Umweltschützern. Sie taten dies, weil und nur weil sie die Möglichkeit sahen, so in dem anschwellenden Massenprotest auch ihre Vorstellungen zur sozialen Frage unterzubringen. „Ökologisch, sozial, basisdemokratisch, gewaltfrei“ – so lauteten die gleichberechtigten Gründungsideen der Grünen, die das erfolgreichste Neugründungsprojekt einer Partei in der alten BRD stabilisierten.
Nun erforderten die Zeitläufe auch den Formwandel der Grundwerte. Manche konkrete Idee der Anfangsjahre musste aufgegeben oder weiterentwickelt werden. An den Werten selbst aber hielt die Partei fest. Während Öko-Pax, die Verbindung von „ökologisch“ und „gewaltfrei“ den Gründungsprozess bestimmte, geriet die Verbindung der Grundwerte „ökologisch“ und „sozial“ beim Abflauen der Friedensbewegung zum Erfolgsschlager. Unsere Forderungen nach umweltverträglichem Wirtschaften wurden in ein „ökologisches und soziales Umbauprogramm der Industriegesellschaft“ gegossen. Unsere ersten klimapolitischen und globalisierungskritischen Konzepte flossen ein in die Programmschrift „Auf dem Weg zu einer ökologisch-solidarischen Weltwirtschaft“. Auch nach dem Austritt zahlreicher sogenannter Öko-Sozialisten 1991 orientierten sich Wahlprogramme an der Idee eines „ökologisch-solidarischen Gesellschaftsvertrags“. (Einer der Hauptautoren ist heute Wirtschaftssenator in Berlin – für die PDS/Linke.)
Auf dieser Grundlage wurde eine aktive Verbandspolitik betrieben: Gewerkschaften, lange Zeit nicht zu Unrecht als Bremser beim ökologischen Umsteuern betrachtet, wurden gezielt im Sinne eines kritischen Dialogs angesprochen, ebenso wie traditionelle Sozialverbände. So wurde eine gesellschaftliche Basis geschaffen, auf der Rot-Grün als politisches Projekt der ökologisch-sozialen Umsteuerung gegen die lange herrschende konservative Regierung erst entstehen konnte. Wohlgemerkt: es ging dabei nicht um Zufälligkeiten der Arithmetik, sondern um bewusst organisierte gesellschaftliche Mehrheiten. Die Betonung der eigenen sozialen Verantwortung und ein nicht zu übersehendes entsprechendes Engagement unterschied die – soziologisch betrachtet – bildungsbürgerliche Mittelschichtpartei „Die Grünen“ nicht nur von den Ego-Liberalen der FDP. Sie machten die Grünen auch zur Zweitoption vieler SPD-Anhänger, die zu grün wechselten, wenn sie von ihrer Partei enttäuscht waren. Die grüne Stammwählerschaft lag Anfang der 1990er Jahre knapp unter 5%. Stammwähler plus rot-grün mit der Präferenz grün bei 12%, mit der Präferenz rot bei 25%. Bis 10,3 % haben wir dieses Elektorat auf der Bundesebene ausgeschöpft (bei der Europawahl 1994).
In den politischen Wirren der deutschen Vereinigung ging dieses Erfolgsmodell verloren. Die Partei war tief gespalten, mehrere Gruppen erhoben den Anspruch, ihr eine neue Perspektive weisen zu können. Der Bundesvorstand unter Ralf Fücks, unterstützt vom sog. „Aufbruch“, legte 1990 ein Leitlinienpapier vor, in dem die soziale Dimension nicht mehr vorkam. Das „Linke Forum“ schaffte es, gemeinsam mit „kritischen Realos“, diesen Angriff auf die Grundwerte abzuwehren und die soziale Kategorie systematisch in das Papier einzuarbeiten. Im Einigungspapier der beiden großen Parteiflügel, das 1991 in Neumünster von Fritz Kuhn und mir ausgehandelt wurde, bekam die soziale Frage wieder ihren konstitutiven Stellenwert. Zugleich wurden die Abkehr vom sozialstaatlichen Traditionalismus und die grüne Verantwortung auch für die Produktivitätsentwicklung und kleinere und mittlere Betriebe betont. Mit dem „Konsens von Neumünster“ ließ sich leben, nicht nur für die innerparteilichen Linken, sondern auch für die rot-grüne Wechselwählerschar. (Siehe Text: „Absturz und Neubeginn“)
Aber dann kam alles anders. Die aus dem Bundestag geflogenen Grünen-West brauchten Partner in Ost-Deutschland. Im Prinzip bot sich ein breites Spektrum an. Für ein parteiförmiges Engagement aber waren nicht alle zu haben. Letztlich spitzte sich alles auf die Fusion der Grünen mit den Bürgerrechtsgruppen zu, die sich im Bündnis 90 zusammengeschlossen hatten. Auch wenn ich selbst als grüner Vorsitzender diese Fusion gemanagt habe – es war die falsche. Genauer: sie wies Bedingungen und Defizite auf, die auf lange Sicht ruinös sein würden. Manche haben das damals geahnt. Aber das öffentliche Sentiment wie auch der innerparteiliche Lobbydruck ließen letztlich keine andere Wahl, als genau diesen Prozess emphatisch zu zelebrieren. Ein Scheitern hätte bedeutet, 1994 das Comeback in den Bundestag zu verpassen – das historische Aus für die Grünen.
Die Bürgerrechtler sträubten sich auch deshalb gegen die Parteiform, weil sie mit der SED schlimmste Erfahrungen gemacht hatten und weltanschaulich quer zum westdeutschen Parteiensystem lagen. Manche von ihnen passten zu den Grünen, andere nicht. Um aber die Westpartei in einem Fusionsprozess, der von gleich zu gleich ablaufen sollte, nicht als Maßstab erscheinen zu lassen, wurde dieser Umstand ignoriert. Die soziale Frage bekam eine paradoxe Funktion. Für viele Bürgerrechtler erschien sozial gleich sozialistisch gleich SED gleich diktatorisch – vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen nachvollziehbar, aber ohne wirkliche Kenntnis der linken Diskurse in der BRD. Sie weigerten sich, diese als „links“ begriffene und verabscheute Dimension als Emblem vor sich her zu tragen. Unterstützung bekamen sie vom „Aufbruch“ um Antje Vollmer (,einer innerparteiliche Strömung), der den Fusionsprozess als Neugründungsakt einer ganz anderen, explizit nicht-linken, eher wertkonservativen ökologischen Bürgerrechtspartei betreiben wollte. Auch Realos um Joschka Fischer drängten in diese Richtung, weil sie sich erhofften, so die Mitte-Links-Mehrheit in der eigenen Partei brechen und die neue Formation Richtung gesellschaftlichem Mainstream treiben zu können. Die Fusionsverhandlungen versuchten so, zusammenwachsen zu lassen, was nicht zusammengehörte. Wie viele Zugeständnisse wurden an einen Günther Nooke gemacht, der die Grünen nach rechts zu ziehen suchte und dann doch lieber zur CDU ging! Für die Linken innerhalb und außerhalb der Partei war dieses Spiel eine Zumutung.
Innerhalb konnten diese Manöver als unvermeidbare Zugeständnisse an die historische Situation kommuniziert werden. Dennoch mussten die Grünen einen hohen Preis zahlen. Zahlreiche Linke, Ökosozialisten, Radikalökologen und sogenannte Fundis verließen die Partei. Nicht um alle war es schade. So manchen unerträglichen Querulanten von damals erkennt man heute mit Schadenfreude bei der „Linken“. Dennoch, auch viel Kompetenz und Engagement in der sozialen Dimension ging verloren, verschwand im Niemandsland oder lagerte sich sogar bei der PDS/Linken an. Auf der anderen Seite blieben auch Semi-Fundis, weil sie bei den Grünen ihr Anliegen, die Bürger- und Menschenrechte, weiterhin gut aufgehoben sahen. Wegen ihnen wurde das stark sozial konturierte „Linke Forum“ aufgegeben zugunsten eines „Babelsberger Kreises“, der in diffuser Form alles zu sammeln versuchte, was sich irgendwie als „links“ begriff. Hier bekamen in der Diskussion um Ausländer, Asyl und Rechtsradikalismus peu a peu westdeutsche Linksliberale wie Claudia Roth und Volker Beck ein wachsendes Gewicht. Sie waren persönlich nicht unsozial, trugen jedoch faktisch dazu bei, die soziale Frage nun von links her im grünen Diskurs und äußeren Erscheinungsbild an den Rand zu drängen. Statt der vier gleichberechtigten Grundwerte kam es zu einer Hierarchisierung. Ökologie und Bürgerrechte (das Kondensat des Grundwertes „basisdemokratisch) dominierten „sozial“ und „gewaltfrei“. Bündnis90/Die Grünen als ökologische Bürgerrechtspartei ersetzen als Folge der deutschen Einheit die sozial-ökologischen Grünen. Der interne Wohlfühlfaktor war hoch, strategisch mit Blick auf die SED/PDS aber wurde ein entscheidender Fehler gemacht.
Der Fehler wiederholte sich, als im schwierigen Grundwertekonflikt zwischen Menschenrechten („basis-demokratisch“) und Pazifismus („gewaltfrei“) die Waage sich zugunsten des prinzipiellen Ziels „Durchsetzung der Menschenrechte“ neigte, auch unter Verzicht auf Gewaltfreiheit. Dass zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr des Völkermordes in einer bestimmten Situation auch militärisch eingegriffen werden musste, war zwar unvermeidlich (Kosovo). Mein Konzept des „politischen Pazifismus“ versuchte diesem Umstand Rechnung zu tragen. Die Realos aber schafften unter dem Druck grüner Neocons wie Fücks und Daniel Cohn-Bendit Gewaltfreiheit als eigenständiges Politikziel faktisch ab zugunsten eines Tool-Box-Ansatzes, der zur zivilen Krisenprävention ein ebenso instrumentelles, zweckrationales Verhältnis hatte wie zu militärischen Mitteln. So wurde auch dieser Grundwert aus der Gründungsphase geopfert und der Pazifismus-Diskurs an die PDS ausgeliefert, die immer noch massenweise von ehemaligen NVA-Offizieren bevölkert ist, die nur deshalb Pazifisten wurden, weil nicht der Warschauer Pakt, sondern die Nato den Kalten Krieg gewonnen hat.
Viele, insbesondere Realos, gingen davon aus, dass nach der Wende die SED-Nachfolgepartei langsam durch Absterben und Absorption verschwinden werde wie nach dem WK II der Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten. Einen aktiven Beitrag der Grünen zur Absorption aber definierten sie nicht. Andere, zu denen ich mich auch zählte, plädierten für eine gezielte und differenzierte Politik gegenüber den ehemaligen Aktivisten der DDR. Wir gingen von drei Strömungen in der SED aus: Altstalinisten, mit denen wir nichts zu tun haben wollten und die in den Orkus der Geschichte fahren sollten; Sozialdemokraten, für die die SPD zuständig wäre; und eine kleinere Gruppe von (ökologischen) Modernisieren, die zu gewinnen unser Ziel sein sollte.
Verhindert wurde diese Strategie durch das parteiinterne Bündnis von ostdeutschen Bürgerrechtlern und westdeutschen Realos, die eine Verfestigung der grünen Linksorientierung fürchteten. Bürgerrechtler legten eine hohe Messlatte für Ostdeutsche an, wenn diese bei uns mitmachen sollten. Die Masse der ehemaligen DDR-Bürger konnte da nur drunter hergehen. Ich selbst war der Meinung, neben schwarz und weiß habe es – wie in der BRD – vor allem grau gegeben. Während die eine grüne Strategie nur „weiß“ akzeptierte, lehnte die andere nur „schwarz“ ab. Von 1000 kleinen Gorbatschows, die auch in der DDR gewirkt hätten, sprach ich – verhöhnt von Bürgerrechtlern – in meiner letzten Rede als grüner Vorsitzender. Sie gälte es zu gewinnen. Ich plädierte für aktive Grauzonenarbeit. Dahinter stand die Vorstellung, dass man nicht beliebige, unpolitische Kreise für grüne Politik neu interessieren könnte. Man müsse den aktiven Kern der ehemaligen DDR-Gesellschaft ansprechen, insoweit er sich nicht durch stalinistisches Gebaren diskreditiert hatte, und in einen kollektiven Lernprozess einbeziehen. Nur so könnten wir eine wirkliche Verankerung in den Neuen Ländern gewinnen.
Die Grünen entschieden sich anders. Auch unter dem Druck der CDU, die zu Lasten einer linken Mehrheit in Deutschland ehemalige DDR-Aktive zu Unberührbaren erklärte. Die Exklusiv-Fusion mit den ehemaligen Bürgerrechtlern kam zustande. Aber es erwies sich bald, dass wir nicht mit einer breiten Massenbewegung fusioniert hatten, sondern mit einem zwar interessanten, aber recht kleinen Klübchen mit geringer Verankerung im Osten. Viele Ex-DDR’ler, die weder zum diskreditierten Kern der SED-Gesellschaft noch zur bekennenden Opposition gezählt hatten und gern zu uns gekommen wären, blieben draußen. Das war das Falsche an der Fusion. Nachdem sie sich jahrelang am Fenster zum grünen Kreisverband die Nase plattdrückten, zu Recht zu stolz, sich hochnotpeinlichen Befragungen über ihr bisheriges Leben auszusetzen, gingen sie dorthin, wo sie eigentlich am wenigsten hinwollten – (zurück) zur (gewandelten) SED. Damit war das Projekt, die SED durch Absorption zum Absterben zu bringen, gescheitert.
Zugleich bestand damit die Gefahr, dass das Parteiensystem sich nachhaltig zu Ungunsten der Grünen verschieben würde. Doch statt sich mit der einzig erfolgversprechenden Politik dagegen zu wehren – nämlich der prägnanten Betonung der eigenen sozialen Orientierung und des politischen Pazifismus -, beschloss man aus Angst vor dem Tod den Selbstmord. Das Soziale wurde der PDS ausgeliefert, grün war ökologisch-bürgerrechtlich. Damit versperrten sich die Grünen nicht nur selbst den Weg nach Osten, sondern luden die PDS geradezu nach Westen ein.
Direkt nach der Bundestagswahl 1994 begann das Verhängnis. Joschka Fischer schaffte es als Fraktionsvorsitzender, den grünen Diskurs in seine Bahnen zu lenken. Zunächst wurde die aufkeimende Globalisierungskritik erstickt. Dann wurde den Öko- und Neoliberalen wie Oswald Metzger freie Bahn zum Ausbreiten ihrer Ideenwelt gegeben, bis in der grünen Wirtschafts- und Finanzpolitik die soziale von der liberalen Dimension verdrängt und entsprechendes Lob aus der Wirtschaftspresse zu vernehmen war. Dann schwang sich Fischer zum Retter des Sozialstaats auf, in eher sozialdemokratischer Form, erklärte diesen zum grünen Herzensanliegen, das wir nie aufgeben würden, für dessen Realisierung aber in einer Koalition die SPD zuständig sei. Joschka inszenierte sich so als neue Mitte in einer von ihm selbst nach rechts verschobenen Fraktion.
Die soziale Frage wurde nicht mehr emanzipatorisch gewendet, als Aufforderung, ungerechte Strukturen zu bekämpfen. Sondern die Tatsache, selbst der Mittelschicht anzugehören, sollte nun auch in eine entsprechende Interessenorientierung münden. Als guter Bürger sollte man zwar auch den Armen geben, das war der Unterschied zur FDP – doch nur als subsidiäre sozialstaatliche Verpflichtung, Strukturelle Ungleichheit und Ungerechtigkeit wurden nicht mehr thematisiert, sondern durch moderne Sozialhilfekonzepte von der Grundsicherung bis Harz IV abgemildert. So sollten wir – statt alternativer Kleinpartei – linksbürgerliche Mittelpartei werden. Es kam wie absehbar: Nicht Mittelpartei, sondern von der Mittelschicht zum Mittelstand, zur Partei der Mitte, des Mittelmaßes und der Mittelmäßigkeit. Die grüne Fraktion betrieb in der Folge eine Politik zwischen Neoliberalismus und einer konservativ-subsidiär bis sozialdemokratischen Sozialpolitik. Die in diesem Bereich aktive „Linke“ Annelie Buntenbach, die traditionalistisch linksgewerkschaftliche Positionen vertrat, wurde veralbert und marginalisiert (Sie war ein dankbares Opfer, trat aus und wurde Mitglied des DGB-Bundesvorstandes. Ich selbst hatte lange Zeit versucht, neben der Friedenspolitik Wirtschafts- und Sozialpolitik aus emanzipatorisch-linker Sicht mitzuformulieren, entschied mich dann aber für die gleichermaßen wichtige und umstrittene Außen- und Friedenspolitik – eine Entscheidung, zu der ich stehe, auch wenn sie mich meine Basis im Ruhrgebiet gekostet hat.)
Mit einer solchen Politik war es schwer, dem Wiedererstarken der SED/PDS zur Linkspartei Einhalt zu gebieten. Die rot-grüne Regierung erledigte den Rest. In gewissem Umfang war dies unvermeidbar. Dass Traditionalisten, die Globalisierung und demographische Entwicklung nur als Gegenstand von Ideologiekritik wahrnehmen wollen, sich abwendeten, war nicht zu verhindern. Aber ein Teil war hausgemacht. Harz IV konnte ohne gelungene Harz I – III nicht funktionieren, wurde aber – um überhaupt ein Wahlthema zu haben – gepuscht. Zudem war es der oft arrogante und besserwisserische Diskurs der rot-grünen Führungsriege, der viele Verunsicherte abgeschreckt – und die eigene „zweite Reihe“ demotiviert – hat. Lasst uns mal ran, wir sind die bessere Elite – das war zu oft die zentrale Botschaft von Schröder/Fischer/Trittin. Das Zelebrieren des eigenen Aufstiegs aus prekären Lebensverhältnissen in die Toskana-Fraktion. Die Verfestigung einer intransigenten grünen Nomenklatura. Falscher Überschwang allenthalben. Nichts gegen einen öffentlichen Sekt zum Erfolg – aber wenn „linke“ Grüne nach gewonnener Wahl wie Formel1-Idioten Schampus verspritzen, den viele potenzielle Wähler sich nie leisten könnten, dann wirkt das abstoßend.
Nach dem Ende von Rot-Grün hätte es vielleicht die Chance gegeben, die verhängnisvolle Entwicklung aufzuhalten, umzudrehen. Doch in den Steuerungszentren von Partei und Fraktion schien man vor allem die Sorge zu haben, wer Joschka als Spitzenkandidat nachfolgt – ein Spitzenkandidat, den die Grünen gar nicht brauchen. Dann erklärte man kurz vor der Hessenwahl die Dick-und-Doof-Nummer zur Strategie. Gut, Koch ist bestraft, aber die Grünen haben am wenigsten dazu beigetragen, wenn man die Ergebnisse sieht. Gegen Rassismus und zugleich für soziale Gerechtigkeit – das war die Erfolgsstory.
Dieser Text wurde nach den Wahlen in Hessen und Niedersachsen geschrieben. Das Ergebnis in Hamburg am 24. Februar 2008 hat die pessimistische Prognose in bizarrer Weise bestätigt. Die deftige grüne Niederlage wird als Chance für schwarz-grün schöngeredet. Wohlgemerkt in einem Landesverband, der einst der am weitesten linke und zugleich stärkste der Grünen war. Nun kann Schwarz-Grün auf kommunaler Ebene durchaus einmal funktionieren. Lokale Probleme, das Personal und die typische face-to-face-Kommunikation können so spezifisch sein, dass diese Kombination eine Zeit lang trägt. Nur kein Dogmatismus! Anders aber sieht es auf Landes- und Bundesebene aus. Gesetzgebung fußt immer auf weltanschaulicher Orientierung. Schwarz-grüne Spekulationen würden die rot-rot-grüne Wechselwählerschaft massenweise vertreiben. In der Hansestadt kommt es nun sehr darauf an, ob Schwarz-Grün als lokale Besonderheit definiert oder als Präzedenzfall, Auftakt, strategische Option verkauft wird.
Die Grünen haben die entscheidende Schlacht gegen die Westausdehnung der Linken verloren. Weil sie sich vor 15 Jahren geweigert haben, mit den verunsicherten und Orientierung suchenden Zerfallsprodukten der SED-Gesellschaft zu reden, sind sie heute gezwungen, aus einer Position der Schwäche mit ihnen zu verhandeln. Sie haben sich in eine ausweglose strategische Position gebracht, die sie nun tapfer als neue Chance verkaufen. Ihr Schicksal wird es aller Voraussicht nach sein, als eine von zwei Kleinparteien der einen oder anderen Volkspartei zur Mehrheit zu verhelfen. Rot-rot-grün oder Ampel, gar Schwampel (schwarze Ampel, später als Jamaica bezeichnet) – die Entscheidung wird die geschwächte Partei einer neuen Zerreißprobe aussetzen und die Linkspartei weiter stärken, so oder so. Interessant, dass die Leitkommentare den Grünen keinen eigenen strategischen Willen mehr zutrauen, sondern sie in diversen Arithmetiken einfach mitverbuchen: Funktionspartei der Mitte. Das war einmal die FDP. Nun haben die Grünen die Liberalen auch hier beerbt. War es das, was sie 1980 bei Gründung wollten? Die Grünen werden ihre Marginalisierung durch Banalisierung und ihr Entscheidungsdilemma nur überleben, wenn sie Koalitionen mit FDP oder Linken gleichermaßen als Option akzeptieren. Nur wenn der eine Flügel die Vorlieben des anderen mitzutragen bereit ist, wird die Partei sich nicht zerlegen.
Und nur wenn der Oppositionscharme der Linken dekonstruiert wird, indem man diese Partei durch Regierungsbeteiligung dem Fundi-Realo-Streit aussetzt, der einst die Grünen spaltete, tun sich neue Horizonte auf. Wenn die Integrationskraft der Gysis und Biskys nachlässt, könnte es – best case aus grüner Sicht – zu einer Entmischung kommen bei den Linken. Ökologische Modernisierer könnten sich scheiden von Fundis, Querulanten und Stalinisten. Dann gäbe es die Chance, den Dialog, der einst verpasst wurde, mit neuen strategischen Optionen zu führen …