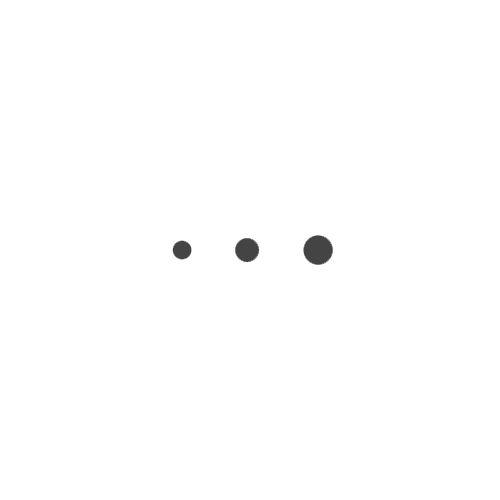(2007, anlässlich des Besuchs des Dalai-Lama in Berlin, bisher unveröffentlichter Teil einer Expertise für eine deutsche Wirtschaftsdelegation vor ihrem China-Besuch)
Durfte Bundeskanzlerin Merkel den Dalai-Lama im Kanzleramt empfangen? Hätte sie ihn außerhalb des Gebäudes, das staatliche Hoheit repräsentiert, sprechen müssen, in ihrer Parteizentrale, im Ashram oder beim Edel-Italiener? War ihr Date Ausdruck eines kompromisslosen Einsatzes für die Menschrechte in China? Oder hat sie damit den Betroffenen in Tibet eher geschadet? Ging es ihr letztlich nicht nur um Pluspunkte in der medialen Eindruckskonkurrenz der Innenpolitik? Wurde Außenpolitik wieder mal für die innenpolitische Selbstinszenierung missbraucht?
Während Kritiker in Deutschland meinen, die Kanzlerin hätte den Chinesen einen öffentlichen Gesichtsverlust zugemutet, meinen die Chinesen, die Kanzlerin habe selbst ihr Gesicht verloren. Denn wer wenige Wochen nach dem Beschluss des chinesischen Parteitags, zukünftig eine nicht provokative, berechenbare Außenpolitik zu machen, die chinesische Seite dermaßen brüskiert, der disqualifiziere sich selbst. Und wer dann noch öffentlich auftrumpfe, die chinesische Seite werde aus wirtschaftlichen Gründen die politische Brüskierung schlucken, provoziert geradezu die Neigung in Peking zu harschen politischen Antworten. Schließlich kann Peking nicht den Eindruck entstehen lassen, es funktioniere nach dem Drehbuch Berlins.
Hinter der tagespolitischen Diskussion über das außenpolitische Geschick der Kanzlerin und die Verstimmungen mit Peking steht ein viel tiefer gehendes Problem, das die Außen- und Sicherheitspolitik in den nächsten zwei Dekaden grundsätzlich umwälzen wird. Gemeint ist eine dramatische Verschiebung der geopolitischen Kräfteverhältnisse. In Deutschland scheint man immer noch zu glauben, wenn nicht als Nationalstaat, so doch im Bunde mit den anderen Europäern eine prägende Rolle in der Weltpolitik zu spielen, zumindest als moralische Instanz. Man empfindet sich als Subjekt der internationalen Politik, welche sich mit dem transatlantischen Partnersubjekt, den USA, teils streitig, teils anbiedernd darüber verständigt, wie mit den Objekten der Staatenwelt umzugehen sei. Objekte sind immer noch alle, die nicht zur westlichen Welt, zur Welt der OECD, gehören. Zwar wird auf internationalen Konferenzen mittlerweile die Partnerschaft auf Augenhöhe betont, wenn man aber auf die außenpolitische Diskussion in Berlin schaut, so erkennt man unschwer, dass fremden Völkern immer noch der Objekt-Status zuerkannt wird. So den Chinesen, den Arabern, den Afrikanern.
Es darf einen nicht wundern, wenn diese selbstbewusster gewordenen Völker und Nationen zunehmend beleidigt und gereizt reagieren. Nimmt man in China an einem Kongress zu geopolitischen Fragen teil, so erfährt man, wer denn die kommenden Weltmächte sind: die USA nach wie vor, dann China, dann Indien. Keine Rede von Europa, erst recht keine Rede von den niedlichen Einzelstaaten mit weniger als 500 Millionen Einwohnern. Europa, Deutschland, sind gern gesehen als Lieferanten von Ideen, Technologien, Know-how. Aber sie sollten sich nicht einbilden, in der Welt der nächsten Dekaden eine bestimmende Rolle spielen zu können. Diese Diagnose wird auch dann nicht falsch, wenn sich Europa tatsächlich zu einer gemeinsamen Außenpolitik durchringen sollte. Denn die geistig-moralische Führung der Welt durch die Europäer und den Westen ist historisch obsolet geworden. Nicht nur, weil die Amerikaner die westliche Glaubwürdigkeit durch Willkür, Kriege und „Double Standards“ verspielt haben, ein Prozess, der auch uns Europäer trifft. Es ist schlicht die Umgewichtung der geopolitischen Bedeutsamkeiten, die auch den verschiedenen konkurrierenden Ideologien neues Gewicht verleiht.
Lange Zeit dachten wir Europäer, wir könnten nicht nur, nein, wir müssten unsere Vorstellung von Aufklärung und westlichen Werten aktiv und offensiv in die Welt hinaustragen. Aus der Conquista und der Mission wurde im Laufe der Jahrhunderte zwar ein Dialogprogramm mit strategischen Partnerschaften. Aber in der Vorstellungswelt der Europäer sind sie selbst dabei immer die Lehrenden und nie die Lernenden. Strategische Partnerschaft, Dialog auf Augenhöhe hieß immer, die Europäer bringen den anderen Völkern Mores bei. Die Menschenrechtsdebatte ist nur der zugespitzte Ausdruck dieser Haltung, die in anderen Gegenden dieser Erde als höchst arrogant und anmaßend empfunden wird.
Die Europäer hatten mit der Globalisierung die Vorstellung verbunden, neue Absatzmärkte zu schaffen für ihre qualifizierten Produkte. Nur die Wenigsten kamen auf die Idee, dass die Schwellenländer und neuen Wachstumsregionen ihrerseits als Produzenten auftreten und uns auf den Weltmärkten Konkurrenz machen könnten. Gar niemand kam auf den Gedanken, dass neben der ökonomischen Position ideologische Geltungsansprüche wachsen könnten. Denn Globalisierung wurde aus westlicher Sicht gleichgesetzt mit der Durchsetzung der Marktwirtschaft, begleitet vom liberalen Politikmodell und von einer technologischen Rationalität, die ihren Ursprung angeblich in westlicher Aufklärung hat. Eine Debatte fand höchstens über die Frage statt, ob der ökonomische Prozess an sich wertfrei sei oder durch christliche Werte gesteuert werden müsse.
Nun aber zeichnet sich ab, dass bei den neuen wirtschaftlichen Schwergewichten auch das Selbstbewusstsein wächst, was den Wert ihrer eigenen Denk- und Deutungssysteme angeht. Warum sollen Chinesen die westliche Auffassung christlicher Werte übernehmen, wenn ihre Wachstumsraten – aus westlicher Sicht das entscheidende Kriterium für Fortschritt – größer sind als die der etablierten Wirtschaftsnationen? Zeigt sich im chinesischen Wirtschaftswunder nicht die Macht der eigenen, chinesischen Denktradition, des Konfuzianismus? Sind die asiatischen Werte, die auf dem Konfuzianismus beruhen, nicht ebenso wirkungsmächtig wie die christlichen? Warum soll die arabische Welt angesichts ihrer Boom-Towns am Golf Abschied nehmen von ihrer Auffassung von Tradition? Gewiss gibt es große Regionen in Arabien, in denen eine konservative Auffassung des Islam wirtschaftliche Entwicklung be- oder verhindert. Doch zumindest am Golf zeigen sich Beispiele dafür, wie Moderne mit arabischer Tradition zu verbinden ist.
Die Bedeutung christlich-abendländischer Wertorientierung wuchs mit dem Aufstieg Europas zur prägenden Kraft auf dem Globus. Weil es besser als andere Völker verstand, aus Eisen Waffen zu schmieden. Und sie konnte sich solange behaupten, als zumindest aus eurozentrischer Sicht der Globus aus Europa plus Entwicklungsländern bestand, die man „entdeckt“ hatte. Nun aber werden aus einigen der ehemaligen Entwicklungsländer Großmächte. Damit wird ein bestimmender Faktor für das europäische Selbstbewusstsein untergraben. Die Welt wird nicht mehr von Europa aus definiert. Multipolarität ist nicht nur ein Faktor, der in den Theorien und Strategien der Außen- und Sicherheitspolitik zentral wurde, Multipolarität verwirklicht sich zunehmend im Geltungsanspruch von Ideologien, Weltanschauungen und Deutungssystemen. Dies ist der Grund dafür, dass die USA die unipolare Welt wollen.
Es ist dieser Hintergrund, der China so allergisch auf die Einlassung der Kanzlerin reagieren lässt, die sich zudem demonstrativ mit George W. Bush verbündet hat. Gewiss kann man aus europäischer Sicht in China Vieles verbesserungswürdig finden. China allerdings ständig subtil oder öffentlich wegen der Verletzung von Menschenrechten anzuklagen, wirkt dort nicht nur beleidigend, sondern ist objektiv fragwürdig, weil vereinseitigend. Sicher, China meint, wegen der gleichwertigen sozialen Rechte die politischen aushebeln zu dürfen. Umgekehrt aber hält der Westen gern die politischen Freiheitsrechte hoch und übersieht dabei die sozialen Menschenrechte. Die chinesische Politik hat es in den letzten Dekaden immerhin geschafft, bei einem Sechstel der Menschheit, das zuvor von Verelendung und Hungertod bedroht war, zumindest die Grundbedürfnisse zu sichern. Damit wurde eine wesentliche Dimension von Menschenrechten erfüllt. Denn Überleben ist das wichtigste Menschenrecht. Defizite gibt es im Bereich der politischen Rechte. Aber die gibt es nicht nur in China. Wenn etwa über die Todesstrafe diskutiert wird, dann mag ein Finger auf China zeigen, vier andere weisen zurück in die Welt des Westens und seiner Verbündeten. Die höchste Rate an Todesstrafen pro Kopf der Bevölkerung findet sich in Singapur, einem lieben Partner des Westens.
Die Größe des chinesischen Reiches führt zu optischen Täuschungen. Dortige Menschenrechtsverletzungen sind immer dem Staat China zuzuordnen. Nehmen wir einen vergleichsweise großen Raum im Westen. Alle OECD Staaten zusammen haben so viele Einwohner wie China. Menschenrechtsverletzungen in diesem Raum werden allerdings nicht einem Staat zugeordnet, sondern zahlreichen, die je einzeln deshalb eine scheinbar gute Performance haben. Der Westen als Ganzer aber, und das wäre die chinesische Sicht, steht kaum besser da als China selbst.
Europa ist nicht mehr die maßgebende moralische Instanz, und sie ist es nie zurecht gewesen. Die größten Menschenrechtsverletzungen gingen aus dem Raum hervor, der heute Europa heißt. China war eine Hochkultur, als wir Germanen noch hordenweise durch den Urwald schweiften. Und hatten den Buchdruck nicht eigentlich die Chinesen schon lange vor Gutenberg erfunden? Über Jahrtausende waren wir die Rückständigen und andere Völker waren weiter. Nehmen wir Deutschland auf dem Stand der Produktivkraftentwicklung, den China heute hat: Wir waren damals eine Ansammlung von Entwicklungsdespotien, auf dem Weg vom Mittelalter in die Moderne. Niemand hielt uns eine Menschenrechtscharta vor die Nase. Technologische Entwicklung bei heruntergekommener Ethik führte dann in den Nationalsozialismus. China war Opfer der Achsenmächte, der Aufstieg Maos und die menschenverachtende Kulturrevolution waren Folge auch der Befreiungskämpfe. In Deutschland existiert die Demokratie noch keine zwei Jahrzehnte. Dürfen wir heute Länder kritisieren, weil bei ihnen nicht in derselben Nacht alle Mauern fielen? Ist Gleichzeitigkeit ein Postulat, das uns eine Mission auferlegt? 150 Jahre vor uns hatten andere die Demokratie und haben uns nicht beschimpft. Es wird 150 Jahre dauern, bis weitere Völker sie erringen.
Konservative Regierungen haben die Menschenrechtsfrage oft in den Hintergrund gestellt, nicht aus Verständnis für andere Völker, sondern zur außenpolitischen Interessenwahrung im Bereich von Sicherheit und Wirtschaft. Es war ein großes Verdienst von Grünen und befreundeten Bewegungen, die Menschrechts- und Demokratiefrage nach vorn zu bringen. Aber es war nicht hilfreich, diese Aspekte nun zu verabsolutieren. Eine reine Menschenrechtspolitik, die sich um Sicherheit und Ökonomie nicht schert, muss scheitern! Durch Radikalisierung haben sich Menschenrechtsaktivisten zu oft isoliert. Im besten Fall wurden sie belächelt, im schlimmeren Fall tragen sie zur gewaltförmigen Konflikteskalation bei. Die christlichen Fundamentalisten im und rund ums Weiße Haus wollten – Beispiel Irak – alle Weltregionen der westlichen Denkart unterwerfen. Sie wollten mit Flamme und Schwert die christliche Moral über die „Heidenvölker“ bringen. Ein solches Vorhaben musste in der Katastrophe enden.
Deshalb war es kein ausweichender Trick, als die Rot-Grüne Regierung 1998 mit China einen Menschenrechts- „Dialog“ begann. Hier herrschte die Einsicht, dass es zwecklos ist, mit dem Finger auf Andere zu zeigen, und kontraproduktiv zu glauben, man könne einseitig als Lehrer auftreten. Nassforsches Auftreten etwas zu junger Westler kommt in China nicht gut an, wo auf der Basis des Konfuzianismus dem Alter und der Weisheit Respekt gezollt wird. Aus chinesischer Sicht ist es angebracht, und das entspricht einer Grundkategorie des Konfuzianismus, Probleme abstrakt und allgemein zu definieren und sich im Dialog um deren Klärung zu bemühen. Gemeinsam mit China zu definieren, dass es Rechtsstaats- und Menschenrechtsprobleme gibt, nicht nur in China, sondern auch in Deutschland und anderen Ländern, und dann gemeinsam zu überlegen, wie man überall die Standards heben kann, das war und ist ein erfolgversprechender Ansatz.
Zu der Frage, welche ethischen Standards denn gelten sollen, gab es in den 1970er Jahren eine heftige sozialwissenschaftliche Diskussion. Die Pole bildeten die amerikanische Anthropologin Margret Mead und ihr französischer Kollege Levy Strauss. Mead postulierte, dass es Normen gäbe, die für alle Kulturen und Gesellschaften, also universell, gültig seien; Levy Strauss hielt dagegen, dass jeder Kulturkreis seine eigenen Normen entwickle und deshalb alle in einer Kultur verankerten Normen prinzipiell gleich gültig seien. Normativismus oder Relativismus, das war die Frage. Sie wurde nie endgültig geklärt. Der deutsche Philosoph Jürgen Habermas versuchte, den Streit mit seinem Vorschlag des rationalen, herrschaftsfreien Diskurses zu lösen. Er meinte, wenn sich Individuen der vernunftmäßigen Klärung eines Sachverhaltes ernsthaft und ohne Hintergedanken näherten, müssten sie zu einer gemeinsamen Haltung kommen. So weit aber ist die Realität noch nicht. Also haben wir als gemeinsamen Wertefundus nur die Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nationen. Das ist nicht wenig, aber in ihrer Exegese wiederholen sich die Grundkonflikte.
„Mehr Demokratie und Menschenrechte!“ – diese Parole klingt gut, ist aber falsch, ein Widerspruch in sich. Denn die UNO-Menschenrechtspakte gelten gleichermaßen für Demokratien und Nicht-Demokratien, implizieren also die Existenz von Despotien. Auch hier zeigt der Westen seine doppelten Standards. Wer hat sich jemals darüber aufgeregt, dass in Bhutan eine Despotie herrscht? Im Gegenteil: Denn hier regiert eine Monarchie, die vielen als sympathisch gilt, weil das Volk sich für das glücklichste auf Erden hält. Solange Menschenrechte geachtet werden, wird diese Despotie akzeptiert, mehr noch, aus kulturellen Gründen geradezu verehrt. Jedenfalls wird nicht offensiv die Demokratie eingefordert. Wer den Dalai-Lama verehrt, tritt faktisch für einen klerikalen Feudalismus ein. Wer die kulturellen Minderheitenrechte der Tibeter einklagt, fordert die Akzeptanz einer Nicht-Demokratie. Man kann – und sollte – für die Rechte der Tibeter in China eintreten. Aber man darf nicht China die Abwesenheit von Demokratie vorwerfen, wenn man sie bei einem lamaistischen Tibet akzeptieren würde.
Aus all dem ergibt sich: Es geht nicht um den geschickteren Umgang des Subjekts Europa mit dem Objekt China oder dem Objekt Arabien. Es geht um einen Dialog auf Augenhöhe. Noch sind wir Europäer stark genug, um diesen Dialog von uns aus anzubieten. In einigen Jahren werden Andere bestimmen, welche Diskurse auf diesem Planeten strukturierend wirken sollen. Wir Europäer haben jedes Recht, unsere Sicht- und Denkweisen für uns zu behaupten. Wir haben jedes Recht uns dagegen zu wehren, wenn in 20 Jahren eine Großmacht aus dem Osten versuchen sollte, uns mit den Ideen des Konfuzianismus zu missionieren. Um so wichtiger aber ist es deshalb heute schon, den Dialog zu suchen und uns nicht in der Illusion der eigenen Macht zu sonnen, um dann, wenn die Stimmung global umschlägt, in die Defensive zu geraten.
Man kann mit China über Tibet reden. So wie man mit London über Nordirland reden kann. Ist die Tatsache, dass Tibet fünf Jahre nach der Verabschiedung der UNO-Charta, die solche Schritte verbietet, okkupiert wurde, so entscheidend? Wenn wir das Thema unrechtmäßiger Besetzung und kultureller Unterdrückung diskutieren, warum gehen wir dann nicht zurück zu den Gründungsmythen der westlichen Welt? Dann würden wir sehen, dass die wunderbare Unabhängigkeitserklärung von Thomas Jefferson nur für Weiße galt und nicht für die schwarzen Sklaven, ganz zu schweigen von der indigenen Urbevölkerung, die einer Behandlung unterzogen wurde, die heute als ethnische Säuberung und Völkermord charakterisiert und eine „humanitäre Intervention“ nach sich ziehen würde.
In China ist zu beobachten, dass der Modernisierungsimpuls zu selbstkritischen Fragen führt. Eine nachholende Entwicklung, die es dem Westen gleichtun wollte, hat in vielen Bereichen desaströse Ergebnisse gehabt, schlimmer als beim westlichen Vorbild selbst. Das betrifft zum Beispiel die Umwelt. Das betrifft auch den Städtebau. Aber in beiden Bereichen ist ein Umdenken zu beobachten. Umweltpolitik, humanere Städte stehen im Zentrum der Entwicklungsprogramme der nächsten Jahre. In beiden Dimensionen finden sich auch Überlegungen zur Bewahrung von tradierter Kultur. In chinesischen Großstädten beginnt man, den Wolkenkratzern Pagodendächer aufzusetzen. China beginnt zu begreifen, dass seine Zukunft nicht in einer Moderne liegt, die den zur Hässlichkeit verkommenen „internationalen Stil“ des Westens kopiert, sondern die seine eigenen Traditionen aufnimmt. Und der Potala in Lhasa soll durch einen Park von der umgebenden Moderne abgeschirmt werden.
China beginnt auch zu begreifen, dass der Status des Vielvölkerstaates nicht nur Sicherheitsprobleme mit sich bringt. Gewiss, sie haben dort Angst, dass eine stärkere Autonomiebewegung in Tibet andere Bewegungen entzünden könnte, in Xinjiang, in der inneren Mongolei und den anderen autonomen Gebieten. Sie haben eine Heidenangst davor, dass eine stärkere Demokratisierung zu einem anarchischen Verfallsprozess führen könnte, wie ihn Sowjetunion und Russland unter Gorbatschow und Jelzin erlebt haben. Deshalb versuchen sie, den sozialen und wirtschaftlichen Wandel politisch von oben zu steuern. Wenn die territoriale Integrität Chinas nicht infrage gestellt wird, ist es leichter, die kulturelle Autonomie einzelner Regionen zu bewahren. Weil diese in den letzten Jahrzehnten von chinesischer Seite aus massiv verletzt wurde, haben sich Autonomiebewegungen stärker und radikaler zu Wort gemeldet. Die Aufgabe der internationalen Staatengemeinschaft kann nicht darin bestehen, hier Öl ins Feuer zu gießen. In einem dialogischen Rahmen ist die chinesische Führung darauf ansprechbar, die einzelnen Nationalitäten nicht nur als Bedrohung der Sicherheit zu sehen, sondern als Bestandteil des Reichtums Chinas. Aber – auch hier – ist es nicht Aufgabe der Europäer, die Chinesen zu lehren, wie sie mit diesen umzugehen hätten. Ebenso wenig wie es Aufgabe der Chinesen ist, den Spaniern beizubringen, wie man Katalonien, oder den Italienern, wie man Südtirol zu behandeln habe.
Die Zeit eines absoluten Normativismus ist vorbei. Wir Europäer haben unsere Rolle, der Welt unsere Sitten und Gebräuche beizubringen, ausgespielt. Relativismus bedeutet wiederum nicht, dass wir unsere Werte und Sitten nun beliebig aufgeben sollten. Wenn sie für uns die besten sind, sollten wir dazu stehen. Sie sind Teil unserer Identität. Aber wir müssen begreifen, dass es andere Vorstellungen von Identität gibt, die das gleiche Recht haben wie wir. Verschiebungen in der Geo-Politik, im ökonomischen Kräfteverhältnis und bezogen auf die globale Geltung von Kulturmustern müssen Konsequenzen haben für eine deutsche Außen- und Sicherheitspolitik. Wir müssen umgehen lernen mit den Faktoren des Relativismus und der Ungleichzeitigkeit, damit es nicht zum Clash of Civilisations kommt, den Huntington an die Wand gemalt hat. Was wir brauchen, ist nicht weniger als eine politische Relativitätstheorie.