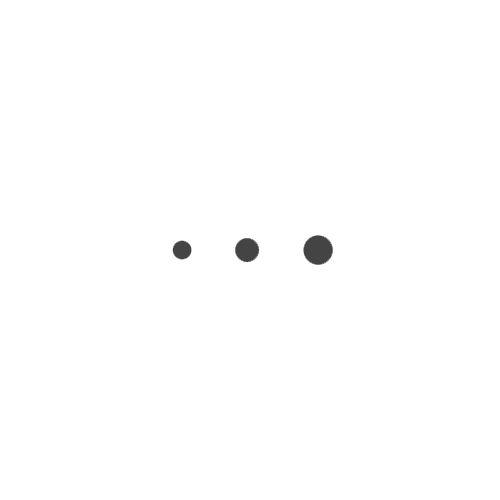(erschienen in der taz, 09. April 1991; der Text steht in einer Reihe von Essays, mit denen ich nach dem Ausscheiden der Grünen aus dem Bundestag am 2. Dezember 1990 versucht habe, der Partei neue Orientierungen zu geben. Auf dieser Basis wurde ich Ende April 1991 zum Parteivorsitzenden gewählt.)
Eine Entscheidungsschlacht, die von Sensationsgierigen herbeigeschrieben wird, kann nur Pyrrhussiege bringen. Es wäre eine schlechte Farce, die Partei, für die es null komma null Alternativen gibt, aufzugeben, nur weil niemand eine festgefahrene innere Streitmechanik durchbrechen kann. Das Wahldebakel bietet dafür die Chance, die letzte. Wenn jenseits von Schuldzuweisungen auf den veränderten gesellschafts- und geopolitischen Hintergrund der Niederlage und auf die realen Bedingungen zukünftiger sozialökologischer Politik reflektiert wird, dürften die Auffassungen bei 80% der GRÜNEN sich wohl durch bestimmte Akzentsetzungen, nicht aber im Grundsatz unterscheiden. Auf dieser breiten Basis ließe sich eine exaktere politische Ortsbestimmung der Partei vornehmen, die das Bild der Zerrissenheit besser korrigiert als die zweifellos nötige Strukturreform.
Es gibt keine „Zeitenwende“, aber die Zeiten haben sich geändert und erfordern eine andere grüne Politik. Ein bloßes Jammern über die Konjunkturflaute der Bewegungen und eine Flucht ins Traumland, wo die verlorenen Schlachten von vorgestern übermorgen doch noch gewonnen werden können, scheint mir eine ebenso defiziente Verarbeitung der Krise zu sein wie das Einschwören auf eine blutleere, visionslose Ökotechnokratie oder das Erheben der Ökologie zur selbstgerechten Quasi-Religion. Deshalb folgender Vorschlag zu einer konsensuellen Ortsbestimmung:
1. Die GRÜNEN verstehen sich als linksökologisch-emanzipatorische Partei, die nicht durch die Parteienlandschaft vagabundiert, aber ökologisch gesinnte Personen anderer Parteien anzusprechen sucht.
2. Soziale Frage und Ökologie bilden ein Koordinatenkreuz alter und neuer gesellschaftlicher Konfliktlinien, die neue Bündnisse nötig und möglich machen. Beseitigung von Armut auf der einen, Durchsetzung des postmaterieller Wertewandels auf der anderen Seite müssen strategisch verknüpft werden: die Lage der unteren Schichten ist zu verbessern, damit sie sich ökologisches Handeln leisten können; für die Mittelschichten muss der komplementäre Verzicht auf materielle Wohlstandsmehrung mit der Aussicht auf verbesserte Lebensqualität verbunden sein. Dieser Interessenausgleich bildet den Ausgangspunkt für eine ökologische Umverteilungspolitik.
3. Um den internen Streit einzugrenzen, definieren wir Arenen, in denen zukünftig unser politischer Disput stattfindet; weit genug, damit sich vieles tummeln kann, aber so eng, dass auch eine Bestimmung des Nicht-mehr-Akzeptierbaren möglich wird. Sie sollen das Spannungsverhältnis zwischen unseren Grundwerten durch möglichst konsensuelle Grundsatzentscheidungen klären und so einen verbindlichen Rahmen für die Diskussion operationaler Politik liefern.
Der Konsens z.B., der die Arena Soziale Frage und Ökologie eingrenzt, könnte lauten: „Das heutige Sozialstaatsmodell, das die sozialen Konflikte der Gesellschaft durch die Verteilung von Wachstumsgewinnen abdämpft, wie auch die klassische sozialistische Utopie, durch eine „Entfesselung der Produktivkräfte“ neuen gesellschaftlichen Reichtum zu schaffen, machen unter den Bedingungen einer notwendigen durchgreifenden Ökologisierung der Produktion und einer Beendigung des pauschalen Wachstumswahns keinen Sinn mehr. Die Sicherung einer menschenwürdigen Existenz und soziale Gerechtigkeit müssen ohne pauschales Wachstum, d.h. durch Umverteilung des erwirtschafteten Reichtums, in der Regel von oben nach unten, und durch eine gleichermaßen ökologische, soziale und demokratische Neubestimmung des Wirtschaftens geleistet werden.“
Derartig gefundene Konsense bilden dann der Rahmen, in dem über die konkrete Politik gestritten werden kann. Eine Politik, die sich über institutionelle Arbeit, Bewegungsbezug und grünes Klüngelwesen hinaus systematisch in Verbände und Wissenschaftskreise erstrecken müsste.
Daneben könnte eine Konzentration auf drei Arbeitsfelder neues Profil und neuen Schwung geben:
1. sozialökologische Politik für Gesamteuropa
Die Auflösung des Ost-West-Konfliktes und die deutsche Einheit haben den nationalen Rahmen, auf den sich ein Großteil unserer Politik bezieht, ausgedehnt und gleichzeitig neu international eingebettet. Daraus resultiert eine doppelte Aufgabe: unsere innenpolitisch ausgerichteten Konzepte müssen entsprechend den besonderen Erfordernissen der hinzugekommenen Bundesländer überarbeitet werden. Im Vordergrund muss dabei die Vermittlung ökologischer Sanierungs- und Präventivmaßnahmen mit den sozialen Ansprüchen der ehemaligen DDR-BewohnerInnen stehen. Der ökologische und soziale Umbau dieser Region mit ihren intensiven Bindungen an die Staaten und Regionen Osteuropas muss zudem mit den existierenden Umbaukonzepten für das ehemalige Westdeutschland mitsamt seiner EG-Bindung verzahnt werden. Gefragt ist eine neue Konzeption von Gesamteuropa.
2. Nord-Süd-Konflikt und neue Kriegsgefahr
Die vertikale Teilung der Welt in zwei hochgerüstete Supermächte scheint nun durch die horizontale abgelöst zu werden. Der „Norden“ steht dem „Süden“, die „moderne“ Welt der „traditionellen“, die „schnellen“ Staaten stehen den „langsamen“ gegenüber. Der OECD-Block nutzt seine strukturelle Vormachtstellung aus, um den unterlegenen Regionen eine Vorstellung von der einen Welt aufzuzwingen, die in erster Linie im Interesse der reichen Industrienationen liegt. Die sich abzeichnende Neuordnung der Welt erfordert von uns eine Überprüfung unserer außenpolitischen Positionen: während wir bereits umfassende Thesen für eine ökologisch-solidarische Neuordnung weltweiter Wirtschaftsbeziehungen – auch als präventive Friedenspolitik – entwickelt haben, warten unsere abrüstungs- und sicherheitspolitischen Aussagen auf eine Aktualisierung. Wie kann unsere Forderung nach Verlassen des NATO-Zusammenhangs in die Vorstellung einer globalen Sicherheitspartnerschaft einmünden? Wie müssen wirtschaftliche Konversionsprozesse bei uns und anderswo aussehen, die unumkehrbar die Waffenproduktion abbauen?
3. Modernisierung und Tradition
Im kommenden Jahrzehnt wird sich die Frage entscheiden, ob sich technologische Innovation und gesellschaftliche Modernisierung ungehemmt durchsetzen und traditionelle Lebenswelten endgültig an den Rand drängen werden. Völker, die sich gegen die Einverleibung in die Geldwirtschaft sperren, sind bedroht; bäuerliche und handwerkliche Produktionsweisen, die sich nicht auf die Erfordernisse des Weltmarktes einlassen, werden zurückgedrängt; Nachbarschaften und zwischenmenschliche Solidarität fallen der Zerstörung gewachsener sozialer Bezüge zum Opfer. Zum anderen aber sind Vorteile der Modernisierung nicht zu leugnen. Und schon gar nicht können wir uns individuell der umfassenden Modernisierung völlig entziehen. Wir brauchen eine neue Debatte über Maß und Richtung gesellschaftlicher Modernisierung, bei uns und global. Wir müssen diskutieren, welche Lebenswelten gegen das „Vordringen des Systems“ verteidigt werden müssen, und welche so rückschrittlich sind, dass ihre Überwindung ein Glück wäre. Das betrifft zum Beispiel die Verteilung der Geschlechtsrollen. Eine tiefgehende Diskussion dieser Fragen soll dazu beitragen, dass zwischen den „wertkonservativen“ und den „linken“ Strömungen unserer Partei ein neues Verständnis erwächst.