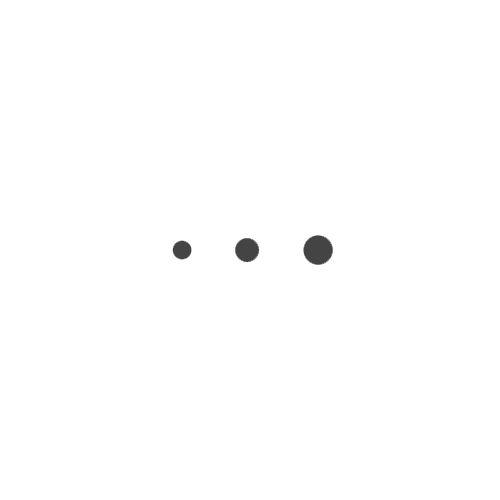(an meinem persönlichen Beispiel: im Nachhinein sieht es nach einer Karriere aus, doch eigentlich ist es ein Zickzack-Kurs, der jederzeit den endgültigen Absturz bringen konnte. Kandidaturen für Ämter und Mandate finden in einem komplexen Umfeld statt, sehen fairen Wettbewerb und grobes Foulspiel, strategische, konzeptionelle, fachliche, kommunikative Kompetenz oder die Diktatur der Mittelmäßigkeit…Nicht nur zur eigenen Erinnerung habe ich all meine Kandidaturen nach meinem Ausstieg bei der Bundestagswahl am 18. September 2005 aufgeschrieben, auch zur historischen Spurensicherung und zur Motivation oder – Abschreckung. VORSICHT: Der Text ist sehr lang und enthält eklige Passagen.)
Vorgeschichte seit 1969
„Kandidierst Du für den Bundestag?“ Ich reagierte verdutzt, als Hans Verheyen mich eines Abends im Dezember 1982 anrief. Auf die Idee wäre ich selbst nie gekommen. Ich wehrte ab, ich sei dabei, meine Doktorarbeit zu schreiben. Damit war die Angelegenheit für mich erledigt. Am nächsten Abend klingelte Verheyen erneut. Wieder dieselbe Frage. Wieder dieselbe Antwort. Einen Abend später ein erneuter Anruf. Verheyen bestand darauf, ich müsse für den Bundestag kandidieren. Er war einer der Mitgründer der Grünen in NRW und erster Landvorsitzender. Er und einige Freunde machten sich Gedanken darüber, wie die grüne Landesliste für die Bundestagswahl im März 1983 aussehen könne. Im Gründungsprozess hatten sich viele unterschiedliche Charaktere zusammengefunden. Verheyen hielt nicht alle für parlamentsfähig, auch wenn sie Ambitionen hatten. Und nun waren er und seine Freunde auf, wie sie es sagten, „Talentsuche“. Doch wie kamen sich auf mich?
Team 71
Ich war zu dem Zeitpunkt seit über einem Jahrzehnt politisch aktiv, in Projektgruppen und Bürgerinitiativen, an der Universität, im Gründungsprozess der Grünen. Begonnen hatte alles mit dem „Ökumenischen Arbeitskreis Ückendorf“ im Jahre 1969. Christliche Jugendliche aus der evangelischen wie katholischen Kirche taten sich zusammen, um in einer Obdachlosensiedlung am Rande des Stadtteils freiwillige Sozialarbeit zu leisten. In solch einer slumähnlichen Siedlung aus Baracken mit minimaler Infrastruktur wurden damals – meist kinderreiche – Familien zusammengepfercht, die planungsverdrängt waren und auf dem Wohnungsmarkt keinen Ersatz gefunden hatten. Schnell politisierte sich diese Gruppe, benannte sich um in Team 71, nahm Abstand von der Amtskirche und wurde zu einem Kern der politischen Szene in meiner Heimatstadt Gelsenkirchen. Von Beginn an hatte ich eine informelle Führungsposition. Vier Jahre etwa betrieben wir Slumarbeit, gaben den Kindern Nachhilfe und bewegten die Erwachsenen zum Widerstand. Zum Schluss war „unsere“ Siedlung abgerissen, die Familien waren auf normale Wohnungen verteilt worden.
Basisgruppen und Hochschulgremien
Mit diesem Background begann ich 1971 an der Ruhr-Universität Bochum das Studium zweier Hauptfächer: Sozialwissenschaft und Pädagogik. Nach einem dreisemestrigen Intermezzo für den zivilen Ersatzdienst in einem Bochumer Krankenhaus kehrte ich 1974 an die Uni zurück, wo mich die politische Dominanz von linkssektiererischen K-Gruppen auf der einen und konservativen Gruppen auf der anderen Seite der „verfassten Studentenschaft“ erheblich nervte. Zusammen mit meinem Freund Karl-Heinz Lenhart rief ich deshalb an der Fakultät für Sozialwissenschaft eine Gruppe von „undogmatischen Linken“ zusammen. Meine handfesten Erfahrungen mit Glanz und Elend der Bundesrepublik während der Obdachlosenarbeit lenkten mich auf einen zwar „linken“, aber pragmatischen, an den Lebenswirklichkeiten orientierten politischen Kurs.
Nach wenigen Monaten stand die Frage im Raum, ob unsere Gruppe zu den Wahlen zum Fachschaftsrat, der studentischen Vertretung auf Fakultätsebene, antreten solle. Seit Jahren war die Fachschaft dominiert von den maoistischen K-Gruppen KHI (Kommunistische Hochschulinitiative) des KBW (Kommunistischer Bund Westdeutschlands) und dem KSV (Kommunistische Studentenvereinigung) der KPD/AO (Kommunistische Partei/Aufbauorganisation). Wir kandidierten – und gewannen. Ich bekam die meisten Stimmen und schlug die KBW-Chefin, die seit vielen Semestern Platzhirschin (oder wie sagt man/frau?) war. Im Fachschaftsrat standen nun vier von uns gegen zwei KBW‘ler. Für meine „Gruppe SoWi“ saß ich bald in allen wichtigen Gremien der Fakultät. Unser Modell einer links-undogmatischen „Basisgruppe“ machte Schule nicht nur an unserer Uni. „Basisgruppe“ bedeutete: Statt einer strikt, fast militärisch von oben nach unten durchorganisierten Kaderorganisation, wie es die K-Gruppen waren, sammelten sich bei uns unabhängige Geister ohne Hierarchie in freier Assoziation. Vorstände und Starkult gab es nicht.
Auch auf Uni-Ebene hatten wir Erfolg. So zog ich ins Studentenparlament und als studentischer Vertreter in das Universitätsparlament ein. Eine gemeinsame linksorientierte „Fachschaftsliste“ aller Fakultäten, der sich unsere Basisgruppe anschloss, eroberte auch den AStA von den rechts-orientierten Gruppierungen. Nachdem diese Liste an der Frage des Umgangs mit inkorporierten K-Gruppen-Mitgliedern zerbrach und Konservative den AStA zurückgewannen, rief ich mit zur Gründung einer rein undogmatischen Liste der „Basisgruppen“ auf. Bei der nächsten AStA-Wahl bekamen wir die deutliche Mehrheit und gingen eine Koalition mit anderen reformistischen Gruppen ein. Den AStA-Vorsitz schlug ich aus, weil ich inzwischen mein Diplomexamen in der Tasche hatte und ein Promotionsstudium begann. Als Chefredakteur übernahm ich aber die beim AStA angesiedelte „Bochumer Studentenzeitung (BSZ)“, die sich bundesweit unter Studenten ein hohes Ansehen erwarb. Bei der nächsten AStA-Wahl gewannen wir die absolute Mehrheit. Von hier aus betrieben wir mit Erfolg den Plan, die Basisgruppen als starken Block in den Gründungsprozess der Grünen zu führen.
Parteigründung und Kommunalverband Ruhrgebiet
Dafür hatte ich auf bundesweiten Treffen der Basisgruppen plädiert. Folgerichtig beteiligte ich mich Mitte 1979 an der Bochumer Sammlungsbewegung für die Gründung einer alternativen, ökologischen Wahlbewegung – einer „sonstigen politischen Vereinigung“ für die anstehende Europawahl: der „SPV – Die Grünen“. Am 12. Dezember 1979 gründeten wir den Bochumer Kreisverband der zukünftigen Partei „Die Grünen“. Meine erste Aufgabe: Leitung der Delegiertenwahl für den ordentlichen Gründungsparteitag Anfang 1980 in Karlsruhe. Gut ein Jahr später wechselte ich in den Kreisverband meiner Heimatstadt Gelsenkirchen.
Dort hatte ich im „Institut für Wohnumfeldverbesserung“ beim Kommunalverband Ruhrgebiet eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle bekommen. Allerdings währte diese Karriere in der Regionalplanung nur zwei Jahre. Gemeinsam mit zwei Kollegen sollte ich für die Stadt Kamen ein Sanierungsgutachten im Sinne sozialdemokratischer Stadtplanung verfassen, auf dessen Grundlage eine Arbeitersiedlung im Stadtkern, in der 70 türkische Familien wohnten, hätte platt saniert werden sollen. Ich hatte in meinem Teil des Gutachtens nachweisen sollen, dass „die Türken“ ganz besondere Wohnungswünsche hätten, abseits am Stadtrand, mit einem „Schwatz-Platz“ für Frauen und zum Hammelschlachten etc., eine Art Obdachlosensiedlung oder Ausländer-Ghetto. Wir wiesen den Auftrag als rassistisch zurück, wurden aber mit sofortigem Rauswurf wegen Arbeitsverweigerung bedroht. Deshalb gründeten wir im Sanierungsgebiet heimlich eine Bürgerinitiative gegen uns selbst. Der Widerstand gegen die Sanierungspläne wuchs. Wir drei schrieben statt des Gutachtens eine kritische Studie über die Wohnungsbaupolitik und Ausländerintegration im Ruhrgebiet. Fazit: unsere Verträge wurden nicht verlängert, die Siedlung blieb stehen und wurde später, wie wir gefordert hatten, mieterorientiert modernisiert.
Gegen den Rauswurf klagte ich nicht, weil ich die ganze Zeit meine Doktorarbeit im Fach politische Sozialpsychologie weiterbetrieben hatte, für die ich nun die Zeit nutzen wollte. Allerdings klagte ich gegen das schlechte Arbeitszeugnis. Nicht unterstützt wurde ich von meiner Gewerkschaft ÖTV; denn mein Chef war zugleich ÖTV-Vertrauensmann und hatte bessere Beziehungen zur SPD. Auf mich allein gestellt, gewann ich den Prozess; meine Vorgesetzten wurden degradiert oder entlassen, das Institut kurze Zeit später geschlossen.
Meine Erlebnisse beim KVR und meine Rolle bei den „Basisgruppen“ hatten sich herumgesprochen in NRW. Hans Verheyen war bei seiner „Talentsuche“ zu der Einschätzung gelangt, ich sei kampfkräftig genug für den Bundestag.
Bundestagswahl 1983
Landesliste 1983
Als er mich zum vierten Mal anrief, war ich weich geworden. Ich würde für die Landesliste kandidieren, sagte ich zu; aber nicht ernsthaft für einen der vorderen Plätze, sondern maximal für einen sogenannten Nachrückerplatz. Die Grünen praktizierten damals die „Rotation“: nach zwei Jahren sollte die gewählte Crew durch sogenannte Nachrücker ersetzt werden. Ich dachte, auf diese Weise Zeit genug zu haben, um meine Doktorarbeit fertig stellen zu können.
Vorab aber benötigte ich ein „Basisvotum“, das heißt die Nominierung durch meinen Kreisverband. Mein Gelsenkirchener KV war mir nicht wohlgesonnen. Er wurde beherrscht von sektenhaft agierenden, ideologisch verquasten Anhängern des Künstlers Joseph Beuys, die einen ehemaligen linken Studenten aus Bochum nicht durchlassen wollten. So war ich zu einem weit ausholenden Manöver gezwungen: neben den Grünen hatte sich eine „Alternative Liste“ gebildet; viele meiner Freunde machten dort mit. In langen intensiven Gesprächen überzeugte ich sie, kollektiv bei den Grünen einzutreten. In unserer Stadt war kein Platz für zwei alternative Wahlbündnisse. Die Neuen verschafften mir nicht nur die Mehrheit, sondern wurden über Jahrzehnte tragende Säulen der Kommunalpolitik. Die Beuys-Jünger verschwanden langsam, ihr Meister scheiterte bei der Aufstellung der Landesliste.
Mit dem Votum in der Tasche fuhr ich im Januar 1983 entspannt zur Delegiertenkonferenz für die Aufstellung der Landeslisten. Um mich der Versammlung bekannt zu machen, kandidierte ich für den Listenplatz sechs, einen sicheren Platz beim Überspringen der 5%-Hürde. Ich bekam ein ziemlich gutes Ergebnis im ersten Wahlgang, zog meine Kandidatur aber zurück zugunsten von Hans-Werner Senft, eines anderen von Hans Verheyen aufgespürten „Talents“. Senft hatte weniger Stimmen als ich, lag im internen „Verheyen-Ranking“ allerdings, wegen Zugehörigkeit zu seiner ostwestfälischen Region, vor mir. Senft verlor jedoch die Stichwahl, und so musste ich ihn auch beim nächsten Wahlgang wieder vorlassen. Mir war es recht. Denn noch ging es um die sicheren Plätze. Der Favorit verlor erneut, gewann dann aber einen der ersten „Nachrückerplätze“. Den nächsten Platz hätte ich nun ziemlich sicher gehabt, zog aber in der Stichwahl meine Kandidatur zurück zugunsten von Norbert Mann, eines Kandidaten der liberalen Strömung, die sich bis dahin unterrepräsentiert fühlte. Erst als es in einer Blockwahl für jeweils drei Plätze um den Platz siebzehn ging, wurde mein Ehrgeiz angestachelt, weil mit Michael Merkel ein alter Kollege aus Bochumer Uni-Tagen kandidierte. Wir gerieten in der Stichwahl gegeneinander. Dreimal musste hinter den Kulissen gezählt werden, dann stand fest: ich hatte mit einer Stimme Mehrheit gewonnen. Platz siebzehn also, weit genug hinten, aber irgendwie mit im Spiel.
Eine Direktkandidatur um die Erststimme in meinem Wahlkreis Gelsenkirchen lehnte ich ab. Dreizehn Jahre lang war dort mein Vater Günter Volmer Bundestagsabgeordneter für die CDU gewesen. Auch wenn er nicht mehr kandidierte – ich hätte es für unanständig gehalten, Zielfigur oder Projektionsfläche für allerlei vergleichende Spekulation und familiären Voyeurismus abzugeben.
In Ruhe wollte ich nun an meiner Dissertation arbeiten. Aber dann kam alles völlig anders. Bei der Bundestags-Wahl bekamen die NRW-Grünen acht Sitze. Hinzu kamen acht designierte Nachrücker, die in der neugegründeten Bundestagsfraktion intern mit Sitz und Stimme mitarbeiten durften. Sechzehn Leute zogen also nach Bonn. Ich war der erste Nach-Nachrücker. Eine komfortable Situation, wie ich meinte. Doch bereits eine Woche nach Konstituierung der Fraktion kam es zum Eklat. Unser Spitzenkandidat Werner Vogel, ein alter weißhaariger Herr, musste zurücktreten, weil seine Rolle im Nationalsozialismus bekannt wurde. Das hieß für mich: mit meinem Platz siebzehn konnte ich nun in die Fraktion einziehen. Vor die konkrete Wahl gestellt, meine Doktorarbeit zur Theorie sozialer Bewegungen weiter zu verfolgen oder deren Entwicklung praktisch voranzutreiben, gab es eine klare Entscheidung. Ich ging nach Bonn. Einige Monate lang stellte ich die Diss noch zur Hälfte fertig und brach sie dann ordentlich ab, weil die Doppelbelastung nicht mehr zu schaffen war.
Arbeitskreis-Koordination und erweiterter Vorstand
In der Bundestagsfraktion wollte ich mich wegen meiner früheren Slumarbeit dem sozialpolitischen Arbeitskreis zuordnen, doch dieser war überbevölkert von erprobten Sozialpolitikern, Betriebsräten und Gewerkschaftern. Deshalb wendete ich mich der Entwicklungspolitik zu, für die ich wegen einiger privater Abenteuer-Reisen in Drittweltländer und des Studiums entwicklungspolitischer Literatur ein Faible hatte. So kam ich in den außenpolitischen Arbeitskreis AFI (Abrüstung, Frieden, Internationales). Mir wurde die Koordination des Arbeitskreises übertragen, ein komplizierter Job im Aufbauprozess der neuen Fraktion. Als „politischer Koordinator“ wurde ich Mitglied des „erweiterten Fraktionsvorstandes“.
MdB, Wahlen zum Fraktionsvorstand 1985 und 1986
Im März 1985 wurde turnusmäßig der Fraktionsvorstand neu gewählt. Als AK-Koordinator im erweiterten Vorstand hatte ich ein gutes Standing und kam als Kandidat aus der Nachrückercrew in Frage. Ein zweiter denkbarer Kandidat war Christian Schmidt aus Hamburg, der meine Frage, ob er kandieren wolle, entschieden verneinte. Ich hätte ihm den Vortritt gelassen. So aber trat ich zur Wahl an. Der Fraktionsvorstand bestand aus zwei Sprecherinnen und einem Sprecher. Zudem gab es drei parlamentarische Geschäftsführer, der Vorstand insgesamt musste geschlechterparitätisch besetzt sein. De facto gab es also nur einen einzigen Sprecherposten für Männer.
Am Wahltag gab Christian Schmidt überraschend seine Kandidatur bekannt. Die Hamburger Seilschaft, die damals den linken Flügel der Grünen kontrollierte, hatte mich gezielt ins Messer laufen lassen. Ich verlor die Wahl knapp. (Wie ich Jahre später erfuhr, war dies auch ein Racheakt wegen meiner Basisgruppenpolitik an der Uni, die sich auch gegen den Kommunistischen Bund (KB) gerichtet hatte, dem die „Hamburger“ immer noch angehörten. Die Grünen tolerierten damals noch Doppelmitgliedschaften.) Die „Hamburger“ verspielten mit dieser Art Machtpolitik, die viele Linke, z.T. mit erpresserischen Methoden, gegen deren innere Überzeugung nötigte, eine Menge Sympathie.
Nach zwei Jahren vollzog sich mit Ach und Krach die Rotation, ich wurde im April 1985 offiziell Mitglied des Deutschen Bundestages. Eigentlich hätte ich noch warten müssen, da Otto Schily wegen Unabkömmlichkeit im Untersuchungsausschuss zur Parteienfinanzierung länger amtieren durfte. Doch weil eine Kandidatin vor mir auf das Mandat verzichtete, kam ich zum Zuge.
Im Januar 1986 wurde der Fraktionsvorstand erneut gewählt, ich trat wieder an. Als Gegenkandidat präsentierte sich der bekannte gewerkschaftsoppositionelle Betriebsrat Willi Hoss. Dieses Mal gewann ich deutlich und wurde zum bis dahin jüngsten Fraktionsvorsitzenden des Deutschen Bundestags gewählt. (Einige meiner Reden finden sich unter Texte & Kontexte/Recht und Gesellschaft.)
Auch wenn ich nach allgemeiner Meinung keine schlechte Figur auf dieser Position abgab, bereitete sie mir nicht lange Freude.
Bundestagswahl 1987
Landesliste 1987
Denn im Sommer 1986 wurde in NRW sehr frühzeitig die Landesliste für die Bundestagswahl 1987 aufgestellt. Die Nominierung durch den Kreisverband schien dieses Mal reine Formsache zu sein. Aber plötzlich tauchte eine Frau auf, die niemand kannte und die keine Ahnung von Politik hatte, trat dem Kreisverband bei und forderte nach wenige Wochen mit Verweis auf die neu eingeführte Quotenregelung, statt mir für die Direktkandidatur und Landesliste nominiert zu werden. Verwunderung und Empörung machten sich nicht nur bei den KV-Männern breit, sondern auch bei den viel zu wenigen Frauen. Einstimmig wurde in einem Sondervotum, das die Satzung zuließ, die Quotierung ausgesetzt und der Weg für mich frei. Jetzt übernahm ich auch die Direktkandidatur. Die erwähnte Dame trat bald aus. Es war nicht das letzte Mal, dass eine Frau die eigentlich segensreiche Einrichtung der Quote als private Geschäftsidee kaperte.
Nach meinen Leistungen im Bundestag und als amtierender Fraktionsvorsitzender glaubte ich, eine gute Chance auf einen sicheren Listenplatz zu haben. Doch es kam wieder alles anders. Die ungeraden Plätze, beginnend mit eins, waren mittlerweile Frauen vorbehalten. Otto Schily kandidierte für Platz zwei. Ich fand Schilys Auftritte in der grünen Fraktion unakzeptabel, und entgegen dem sich entwickelnden Personenkult meinte ich mit einer Gegenkandidatur ein Zeichen setzen zu müssen. Vier Jahre zuvor hatte ich mich bei einer informellen Beratung von NRW-Köpfen zur Frage, ob wir Schily, der in Berlin durchgefallen war, in NRW eine Chance geben sollten, für ihn ausgesprochen. Es war die entscheidende Stimme beim 4:3-Votum. Ähnlich dachte Eckhard Stratmann, ein Wirtschaftspolitiker aus Bochum, der wie Schily aus der ersten Bundestagscrew hinaus rotiert war. Mit Stratmann war ich intern eher verbündet, ohne dass wir Freunde wurden. Im ersten Wahlgang am Freitagabend erhielt Schily bei weitem die meisten Stimmen und war gewählt. Ich lag hinter ihm, deutlich vor Stratmann.
Am Samstag ging die Aufstellung weiter. Es hätte nahe gelegen, nun für den Platz vier zu kandidieren. Dort aber trat mit Ulli Briefs ein bekannter Gewerkschaftsdissident an, der die Sympathien aller linken Gewerkschaftskritiker hatte. Gegen ihn zu kandidieren, verbot sich, weil wir im selben Reservoir fischten. Also trat ich erst für den Platz sechs an, hatte aber zwischenzeitlich ein verblüffendes Erlebnis. Denn auf einem der Frauenplätze kandidierte eine bis dahin unbekannte Frau; als Bewerbungsrede verlas sie wortwörtlich einen Text von mir, ohne meinen Namen zu nennen! Ich hatte im Bundestag das Thema der Internationalen Schuldenkrise der sog. Dritten Welt politisch aufgeworfen, damit die gesamte Nord-Süd-Diskussion umgekrempelt und eine Vorläuferbewegung der „Globalisierungskritik“ mit ins Leben gerufen. Nun trat diese Frau, die zuvor nirgendwo gesichtet worden war, nicht nur mit „meinem“ Thema auf, sondern klaute auch meinen Text. Thema und Text waren gut – die Dame wurde gewählt (und verzichtete später auf das Mandat). (Essays und Reden zum Thema finden sich unter Texte & Kontexte/Ökonomie und Ökologie. Das Schlaglicht „Campaign global justice“ beschreibt meine Rolle.)
Das Thema war für meine eigene Profilierung verbraucht. Dann kam ein zweites ähnliches Erlebnis. Wilhelm Knabe, Forstwirt und anerkannter Ökologe, kandidierte ebenfalls um den Platz sechs – nicht aber mit dem Thema Waldsterben, das damals das Mega-Thema für alle Ökologen und auch sein eigentliches Gebiet war; aus heiterem Himmel präsentierte er sich als Dritte-Welt-Politiker, zur Verblüffung der einschlägigen Community, die ihn gar nicht kannte und mich als ihren Vertreter sah. Die Versammlung, vor der Frage stehend, wie sie mit dem verdienten Veteranen aus dem grünen Gründungsprozess umgehen solle, zog ihn vor. Ich verlor die Wahl.
Also trat ich – bereits spät abends – für den Platz acht an. Ernsthafter Gegenkandidat war erneut Eckhard Stratmann, der um Platz 6 weit abgeschlagen war. Im ersten Wahlgang fehlten mir trotz der großen Anzahl von Kandidaten nur wenige Stimmen an der nötigen absoluten Mehrheit. Auch im zweiten Wahlgang lag ich acht Stimmen vor dem Konkurrenten. Dann eine weitere merkwürdige Erfahrung: die Versammlungsleitung brach auf Drängen des Landesvorsitzenden Hubert Niehoff die Versammlung kurzerhand ab, statt den dritten Wahlgang durchzuführen und vertagte diesen auf den nächsten Tag.
Nun brach der dritte Tag meiner Hängepartie an. Die Nacht hatte Stratmann genutzt, um, unterstützt von Niehoff, der zugleich Stratmanns angestellter Bundestags-Mitarbeiter war, Delegierte zu bearbeiten und eine Mehrheit zusammenzukratzen. Als am nächsten Morgen sehr zügig der dritte Wahlgang durchgepaukt wurde – „meine“ Gelsenkirchener Delegierten waren wie viele andere noch nicht eingetrudelt -, hielt der Mitarbeiter und Landesvorsitzende – satzungswidrig – eine flammende Rede zur Wahl seines Chefs. Stratmann gewann mit drei Stimmen Vorsprung.
Damit war für mich das Kapitel Grüne erledigt. Die sind ja noch schmieriger als die anderen, dachte ich, verließ die Landesversammlung, begab mich zum Parkplatz und wollte auf nimmer Wiedersehen nach Hause fahren. Da kam mir Lukas Beckmann nachgerannt, ebenfalls Gründungsveteran, Ex-Parteivorsitzender und Fraktionsgeschäftsführer. Ich solle weiter kandidieren, auf Platz zehn würde ich es mit Sicherheit schaffen und der Platz sei aussichtsreich. Aussichtsreich? Sicher waren nur acht Plätze. Als amtierender Fraktionsvorsitzender konnte ich mich auf eine solch unsichere Position eigentlich nicht einlassen. Und überhaupt: mein Leben bestand nicht aus grüner Politik. Es war eine interessante Episode. Ein Ende nach vier Jahren wäre nicht schlimm gewesen. Ich hatte genügend andere Perspektiven, wollte meine Doktorarbeit nun zu Ende schreiben und eine Hochschullaufbahn einschlagen. Eher widerwillig gab ich Beckmann nach, sagte ihm, er könne meinen Bewerbungszettel beim Präsidium abgeben, ich würde vor der Versammlung nicht mehr auftreten. Eine Viertelstunde später kam Beckmann wieder raus: Du bist gewählt, nimmst Du die Wahl an? Ich betrat den Saal, gab dem Präsidium den entsprechenden Wink und verschwand nach Hause.
Einen Tag später trat ich vom Fraktionsvorsitz zurück. Meine schriftliche Begründung war nichtssagend. Meine Freunde kannten die Beweggründe. Wir Nachrücker hatten ohnehin einen schweren Stand in der Öffentlichkeit, weil wir als zweite Wahl galten (was durch einen Vergleich der politischen Biografien übrigens falsifizierbar war). Ein Fraktionsvorsitzender, der einen höchst mittelmäßigen Platz bekam, wäre weiter geschwächt worden und hätte nicht die nötige Autorität besessen, um das Amt in den kommenden Wahlkämpfen optimal ausfüllen zu können. An meiner Stelle wurde Willi Hoss gewählt, der einen sicheren Landeslistenplatz in Baden-Württemberg hatte.
Dann der Wahltag: die Grünen bekamen mehr Stimmen, als sie verdient hatten, ein Ergebnis, das sie lange nicht mehr erreichen sollten. Mitten in der Nacht, zu Besuch in meinem Elternhaus, erfuhr ich vom Wahlleiter das Endergebnis. Die Landesliste NRW zog bis Platz elf. Ich war entgegen meinen Erwartungen wieder dabei
Wahlen zum Fraktionsvorstand 1988
In der neuen Fraktion nahmen die Flügelkämpfe dramatische Formen an. Harte Kampfabstimmungen um den Fraktionsvorsitz und Einzelfragen spalteten die Fraktion. Otto Schily lief zur SPD über. In dieser Situation hatte Antje Vollmer 1988 die Idee, statt der zermürbenden und zersetzenden Einzelkandidaturen um den Fraktionsvorsitz mit einem Sechserteam anzutreten und für eine Gruppenwahl zu kämpfen. Nach langen Gesprächen ließ ich mich überreden, als Vertreter der links-undogmatischen Strömung bei dieser auf Integration zielenden Veranstaltung mitzumachen. Wir sondierten unsere Wahlchancen, hatten ziemlich viel Zuspruch, aber die linken, wie rechten Gegner unseres Modells verbündeten sich und ließen die Gruppenkandidatur scheitern. Freunde versicherten mir Siegchancen bei einer Einzelkandidatur. Aber ich hatte kein Interesse, als Repräsentant einer Strömung oder eines Flügels in Stellung gebracht zu werden. So konzentrierte ich mich in dieser zweiten Fraktion auf die Sachpolitik. Ich organisierte eine breite zweijährige Kampagne zu „meinem“ Thema internationale Schuldenkrise, die in einer Großdemo, einem internationalen Gegenkongress und anderen Veranstaltungen anlässlich des Weltwährungsgipfels 1988 in West-Berlin kulminierte und in ein von mir initiiertes grünes Programm für eine ökologisch-solidarische Weltwirtschaft einfloss. (die englische Version findet sich unter Bücher: ecological economics)
Bundestagswahl 1990
Zu dieser Zeit war die Zweijahresrotation bei den Grünen in NRW durch die Mandatszeitbegrenzung auf zwei ganze Wahlperioden ersetzt worden. Meine zweite lief, ich konnte nicht mehr kandidieren, meine Zeit bei den Grünen war wieder einmal zu Ende. So schien es. Stattdessen wurde meine Lebensgefährtin Marie-Theres Knäpper zur Spitzenkandidatin auf Platz eins der Landesliste gewählt. Ich stellte mich darauf ein, mich um unseren gerade geborenen Sohn zu kümmern und mir einen Job zu suchen, was für halbwegs profilierte Grüne damals nicht einfach war. Die halb fertige Dissertation war inzwischen von den Zeitläufen überholt worden.
Doch wieder einmal kam alles anders. Die Umbrüche in Osteuropa und der Fall der Mauer hatten die deutsche Frage auf die Tagesordnung gesetzt, für deren Lösung wir Grünen uns nicht gegründet hatten. In erbitterten Flügelkämpfen zutiefst zerstritten, waren wir nicht in der Lage, in den historischen Umbrüchen einen Weg zu finden. Bei der Bundestagswahl verfehlten wir um wenige Stimmen die 5%-Hürde. Die gesamte grüne Politik schien gescheitert.
Ironie des Schicksals: Nicht nur ich war aus dem Bundestag geflogen, sondern alle anderen auch, und niemand sonst von den Grünen kam hinein, außer einem kleinen Grüppchen von Ost-Grünen und -Bürgerrechtlern. Ich selbst war nun nicht einfach ein ausgeschiedener Abgeordneter, nach dem kein Hahn mehr krähte. Ich war nun einer der Helden des Untergangs. Die neuen Bundestagskandidaten tauchten in der Öffentlichkeit gar nicht erst auf. Ich wurde als langjähriges führendes Mitglied der grünen Fraktion immer wieder gefragt, woran denn die Niederlage läge und wie es weiter ginge. Diese Fragen zwangen mich, eben über diese Themen nachzudenken.
Parteivorsitz 1991 und 1993
1991 Die Grünen
Statt mich also auf meine neue Rolle als Hausmann zu beschränken, kreisten meine Gedanken um die Zukunft der grünen Politik. Langsam formte sich eine Idee, wie man die gescheiterte Partei, die vor dem Exitus stand, vielleicht wieder beleben könnte. Nach einigen Wochen brachte ich meine Gedanken zu Papier, ließ den Text anonym zirkulieren und spürte, wie neues Leben erwachte, neue Zuversicht, wie Leute sich aktivierten, um am Projekt Rettung der Grünen mitzuwirken. Aus diesem Text wurde eine Resolutionsvorlage für die Bundesdelegiertenkonferenz im April 1991 in Neumünster. Dort wollten eine linke und eine rechte Strömung zur Entscheidungsschlacht um die Richtung der Partei antreten. Sie wollten in der Debatte obsiegen und die unterlegene Strömung aus der Partei drängen.
Mein Papier kam zwar von links, hatte aber den Anspruch, von links her die gesamte Partei zu integrieren, richtete sich also ausdrücklich gegen die Spaltungsversuche der Hardliner beider Flügel. Nun sah sich der Realo-Flügel gezwungen, einen alternativen Entwurf vorzulegen, den Fritz Kuhn formulierte. Die Einbringung meiner Resolution verband ich mit dem dringenden Appell, sich nicht spalten zu lassen, sondern die achtzig Prozent der Partei, die trotz aller Unterschiede miteinander weiterarbeiten wollten, zu Lasten der beiden Extrempositionen zu integrieren. Ich gewann die Abstimmung mit deutlicher Mehrheit. Weil ich aber nicht den Sieg, sondern die Integration der Partei wollte, bot ich Kuhn an, unsere Papiere zu vereinigen. Sechs Stunden verhandelten wir hinter den Kulissen, dann hatten wir ein gemeinsames Papier fertig. Es wurde mit großer Mehrheit von der Versammlung angenommen (und von Unterlegenen als „Burgfriede“ schlechtgeredet). Im Ergebnis waren über achtzig Prozent miteinander versöhnt, links und rechts verließen Polarisierer nicht nur den Saal, sondern auch die Partei.
Die Unterstützer meiner Politik erwarteten von mir die Kandidatur zum Parteivorsitz. Vorab aber wurde eine Satzungsänderung beschlossen. Statt drei gleichberechtigten Sprecherinnen und Sprechern sollte es ein Duo geben, davon mindestens eine Frau. Außer mir waren drei weitere namhafte Männer im Rennen: Die Realos Hubert Kleinert und Helmut Lippelt sowie der DDR-Oppositionelle Carlo Jordan, Mitgründer der Ost-Grünen. Die Partei neigte dazu, Führungspositionen nach Proporz zu besetzen. Der Frauenplatz würde als erster gewählt. Prominente wie Petra Kelly und Antje Vollmer standen zur Verfügung. Wenn auf den Frauenplatz eine Westfrau gewählt würde, würde dann nicht Jordan der Männerplatz zufallen? Wenn eine eher linksorientierte Frau gewählt würde, hätten dann nicht Kleinert und Lippelt bessere Chancen als ich? Überraschend wurde die ostdeutsche Grüne Christine Weiske gewählt, die mit einer beherzten Rede die arrivierten West-Frauen in den Hintergrund drängte. Damit war der Weg frei für einen West-Mann. Aber Weiske hatte sich eindeutig als Linke geoutet. Konnte ich in dieser Situation noch Chancen haben? Im ersten Wahlgang schied Carlo Jordan aus, im zweiten Wahlgang folgte Helmut Lippelt, so dass in der Stichwahl Hubert Kleinert und ich gegeneinanderstanden. Die Wahl ging deutlich zu meinen Gunsten aus. Ich war zum Parteivorsitzenden der Grünen gewählt. Lippelt wurde auf meinen Wunsch hin einer der Beisitzer.
Ich machte Kleinert und den Realos sofort ein Angebot zur Zusammenarbeit. Aber es war unübersehbar, dass Hardliner Joschka Fischer alles daransetzen würde, meinem Vorstand das Leben schwer zu machen, auch wenn die Linken dort keine Mehrheit besaßen. Allerdings waren Realo-Hardliner gar nicht vertreten. Angesagt war kollegiale Zusammenarbeit, um Mehrheiten im Vorstand zusammen zu bekommen. Es gelang mir zunehmend besser, die Mitte-Links-Mehrheit, die ich in der Partei kreiert und stabilisiert hatte, nun auch im Bundesvorstand umzusetzen. Fischer versuchte noch eine Zeitlang, mich zu stürzen, bis er einsah, dass mein Erfolg objektiv in seinem Interesse lag.
Bündnis 90/Die Grünen
Als entscheidendes Ziel gab ich das Comeback der (West-) Grünen im Bundestag aus. Das war nicht so selbstverständlich, wie es klingt. Einige Landesspitzen spekulierten, ohne Bundesebene auskommen zu können. Leute um Lippelt wollten den Vorstand zu Hilfsreferenten der Bürgerrechtler-Gruppe im Bundestag machen. Meine Strategie lautete: 1. Reform der Partei an Haupt und Gliedern. 2. Einsammeln aller wichtigen Einzelakteure durch gezielte Ansprache und Einbindung in Projekte, damit sich das enttäuschte Personal nicht in alle Winde verflüchtigte. 3. Grüne Landesregierungen auch bundespolitisch zur Geltung bringen (Dies implizierte eine Stärkung des hessischen Umweltministers Joschka Fischer, der unserem Vorstand ablehnend gegenüberstand, und des niedersächsischen Ministers Jürgen Trittin, der uns unterstützte.). 4. Am wichtigsten: die Fusion mit politischen Partnern in Ostdeutschland nach Verhandlungen auf Augenhöhe. 5. Investition aller (knappen) finanziellen Mittel in dieses Projekt. Nur Vorstands-Beisitzerin Angelika Beer wurde thematische Sacharbeit erlaubt: das intensive Engagement für die UNO-Kampagne zur Ächtung von Landminen – die Jahre später mit dem Friedens-Nobelpreis ausgezeichnet wurde.
Nach intensiven, schwierigen Vorgesprächen einigten wir Grünen uns mit den Bürgerrechtlern von Bündnis 90 auf eine formelle Zusammenarbeit. Ich wurde Verhandlungsführer der Grünen, wichtigster Counterpart auf der anderen Seite Werner Schulz. Zusammen gaben wir ein Buch heraus zur ökonomischen Perspektive der sogenannten Neuen Länder: „Entwickeln statt abwickeln.“ Trotz aller Widrigkeiten: die Fusion zur gesamtdeutschen Partei Bündnis 90/Die Grünen gelang. Christine Weiske trat aus Protest gegen die Fusion zurück. Ich war letzter Vorsitzender der alten West-Grünen und wurde nach der Fusion automatisch erster Vorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. Bei der Neuwahl des Vorstands der fusionierten Partei gab es keinen ernsthaften Gegenkandidaten. Gemeinsam mit der Co-Sprecherin Marianne Birthler repräsentierte ich die einzige wirklich gesamtdeutsche Partei. Unsere Arbeit hatte Erfolg: uns gelang das Comeback in den Bundestag.
Wegen der damals geltenden Trennung von Amt und Mandat musste ich den Parteivorsitz nach dem Wiedereinzug ins Parlament abgeben. Für das neugegründete Gremium des Parteirates kandidierte ich nicht nach all dem Stress, wohl wissend, dass ich damit meine Position in den Spitzengremien der Partei aufgeben würde – mit allen Nachteilen für zukünftige Kandidaturen.
Bundestagswahl 1994
Landesliste 1994
Für die Bundestagswahl 1994 lief die Nominierung im Kreisverband glatt. Ich übernahm auch die Direktkandidatur. Der Düsseldorfer KV hatte mir die Nachfolge von Schily bei der Direktkandidatur angeboten; ich blieb aber lieber in meiner grünen Diaspora. Als amtierender und erfolgreicher Parteivorsitzender errang ich bei der Aufstellung der Landesliste bei einem Gegenkandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit und wurde als Spitzenkandidat in den Bundestag wieder gewählt.
Die neue Fraktion bot mir keine herausgehobene Position. In der Opposition standen davon nur wenige zur Verfügung. Angesichts der Kräfteverhältnisse fiel Joschka Fischer der Fraktionsvorsitz zu. Die anderen Vorstandsposten gingen quotengerecht an Frauen oder Ostdeutsche. So blieb mir nur die Kandidatur um die wenig bedeutende Position des außenpolitischen Sprechers. Für diese interessierte sich auch Gerd Poppe, ein DDR-Bürgerrechtler, der diese Aufgabe in der Wahlperiode zuvor bereits innehatte. Der Wahlgang endete unentschieden, und ich verzichtete kurzerhand zu Gunsten von Poppe. Die Wahlen waren im Einzelnen plausibel und nachvollziehbar. Dennoch wurde ich das Gefühl nicht los, dass die Fraktion mit dem Parteivorsitzenden, der die Fusion mit Bündnis 90 gemanagt und die Gesamtpartei in den Bundestag zurückgeführt hatte, recht schäbig umging.
Die Fraktionsarbeit polarisierte sich an zwei Punkten. Zum einen an der sozialen Frage, zum zweiten an den Balkankonflikten. In beiden Themen wuchs mir die informelle Führungsrolle der internen Opposition gegen Fischer zu. Fischer hatte es verstanden, den gesamten Diskurs der Fraktion nach rechts zu verschieben und sich selbst als neue Mitte zu inszenieren. Obwohl ich die Mitte-Links-Mehrheit der Partei repräsentierte, versuchte man nun, mich als Außenseiter hinzustellen. Die Presse, angestachelt von Fischer, wollte mich in die Fundi-Ecke schreiben, eine Rolle, die mir überhaupt nicht stand.
Meine Mitgliedschaft in der Bundestagsdelegation zur Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) nutzte ich 1996, um dort neben den anderen existierenden weltanschaulichen Gruppen die grün-alternative Gruppe zu begründen, die mich zu ihrem Sprecher machte.
Bundestagswahl 1998 und 1. Rot-grüne Regierung
Landesliste 1998
Für die Landesliste 1998 handelte man mich wiederum als Spitzenkandidaten, nicht zuletzt deshalb, weil ich in der Bundestagsfraktion die Gegenposition zu Fischer markiert hatte. Mein Kreisverband stand inzwischen geschlossen hinter mir, nominierte mich und übertrug mir die Direktkandidatur. Heftig angefeindet wurde ich im Vorfeld von Eckhard Stratmann, der sich zum Anführer der Linken aufschwingen wollte, um sein Comeback zu erzwingen, dort aber abblitzte. Meine Rivalität zu Fischer brachte es mit sich, dass die Realo-Seite einen starken Gegenkandidaten präsentierte. So kam es zum Stichentscheid zwischen dem Umweltpolitiker Reinhard Loske und mir. Ich konnte die Wahl gewinnen und wurde zum zweiten Mal Spitzenkandidat in NRW.
Kommission für die Koalitionsverhandlungen 1998
Die Bundestagswahl brachte die rot-grüne Mehrheit, für die wir lange gekämpft hatten. Für die Koalitionsverhandlungen mit der SPD wurde eine zwölfköpfige Verhandlungskommission gebildet. Aufgrund meiner innerparteilichen Geltung und der außenpolitischen Kenntnisse – vor wenigen Monaten war ich in diesem Fach zudem promoviert worden – wurde ich Mitglied der Kommission, zuständig für die Verhandlung der Außenpolitik.
Staatsminister 1998
Bei der Vergabe der Regierungsämter beanspruchte Joschka Fischer das Außenministerium, in das er sich seit Wochen von den Medien hatte hineinschreiben lassen. Ich war gegen das Amt, weil damit zu wenig grüne Programmatik umgesetzt werden könne. In einer internen Abstimmung bekam Fischer eine knappe Mehrheit. Ich forderte daraufhin das Amt des Staatsministers im Auswärtigen Amt. Vier Jahre zuvor wäre ich bei einer rot-grünen Mehrheit wohl Minister für globale Fragen (Ökologie, Entwicklung, Klimaschutz) geworden. Seinen Realo Freunden und der Presse gegenüber begründete Fischer seine Zustimmung damit, dass er mich so besser einbinden, d.h. neutralisieren könne. Diese Begründung war genauso bescheuert wie umgekehrt die Hoffnung vieler Linken, ich könne Fischer nun besser kontrollieren. Hier kam es auf beides nicht an. Ich bot kollegiale Zusammenarbeit an. Unser Streit der letzen Jahre – so meine Meinung – habe sich im Prinzip um die richtige Oppositionsstrategie gedreht und nun seien wir gleichermaßen Regierungsmitglieder einer Koalition, die beide seit langem wollten.
Die Zusammenarbeit unter hohem politischem Druck – Kosovokrieg, Terroranschläge und Afghanistaneinsätze, …- entwickelte sich höchst mittelmäßig. Zudem entpuppte sich das Amt des Staatsministers als Unding. Es war mit hohen Erwartungen verbunden, aber mit wenigen Ressourcen ausgestattet. Zur Jahreswende 2001/2002 erfuhr ich aus dem Bundesvorstand, dass die Fraktionsvorsitzende Kerstin Müller meine Stelle wollte. Von mir zur Rede gestellt, stritt sie dieses rundheraus ab. Eine glatte Lüge, wie ich wusste. Auch wurden in NRW aus dem Büro Müller Falschinformationen über meinen Gesundheitszustand gestreut. Es waren typisch grüne Infamien. Einige Zeit früher hätten sie meinen Kampfgeist angestachelt. Doch nach etwa drei Jahren begann ich den Spaß an dem Amt zu verlieren. Ich hatte mich daran begeben, in allen Abteilungen des Auswärtigen Amtes die Reformen durchzusetzen, die mit Bordmitteln zu machen waren. Das hatte ich erledigt. (siehe: „Arbeitszettel“ in „Leben und Politik/Regierung“) Danach hätte ich nun Rosinen picken und den Amtsbonus genießen können, war aber dafür nicht der Typ. Im Amt wollte ich etwas leisten, genießen konnte man besser außerhalb. Ich schlug Fischer eine aktivere Rolle für mich mit Wesisungsrecht in der Nord-Süd-Diplomatie vor, vergleichbar meinen Counterparts in Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Es hätte der deutschen Außenpolitik gutgetan. Fischer aber wollte das Staatsministeramt nicht aufwerten, aus Angst, wie mir berichtet wurde, ich könne ihn beerben wollen. Denn die globale Konfliktstruktur hatte sich von der Ost-West- auf die Nord-Süd-Achse verschoben.
Als Staatsminister mithaften zu müssen für Politiken, die man nicht mitbestimmen konnte (wie die unseligen Hartz-Gesetze, falsche Weichenstellungen in Afghanistan und in der Afrika-Politik…), mein Motivationsverlust plus die Intrigen gegen mich, bei gleichzeitig viel zu kurz kommendem Privatleben, veranlassten mich im Spätsommer 2002 zu der Erklärung, für eine weitere Periode als Staatsminister nicht zur Verfügung zu stehen. Nachfolgerin wurde die Kollegin, die alles darangesetzt hatte, mich zu mobben. „Ich möchte mal probieren, ob ich das auch kann“, eröffnete sie mir bei der Amtsübergabe – Regierungsarbeit als Selbsterfahrungstrip. Glücklich wurde niemand damit. Als Staatsminister hatte ich – statt der beamteten Staatssekretäre – regelmäßig dem Auswärtigen Ausschuss des Bundestages berichtet und mich intensiven Diskussionen unter Profis gestellt. Die Neue bekam nach ihrem dritten Vortrag wegen erwiesener Unfähigkeit vom Ausschussvorsitzenden Auftrittsverbot.
Bundestagswahl 2002
Landesliste 2002
2002 stellte sich die Frage, ob ich ein drittes Mal Spitzenkandidat in NRW werden solle. Mein Kreisverband unterstützte mich, obwohl ich bat, dass jemand Anderes die Direktkandidatur übernehmen möge. Als Staatsminister hatte ich zu viele Präsenzpflichten im Ministerium, um Straßenwahlkampf in der grünen Diaspora machen zu können. Zudem war ich bundesweit gefragt. Für die Spitzenkandidatur auf der Landesliste fand ich selbst eine Person aus dem profilbildenden Bereich der Umweltpolitik geeigneter. Zudem hatte ich als Staatsminister wegen der schwierigen Entscheidungen beim Kosovo-Krieg und dem Kampf gegen den internationalen Terrorismus mit der Intervention in Afghanistan große Teile meiner alten linken Basis verspielt, die mir die Zerstörung ihres Weltbildes vorhielten. Den Flügel wechseln wollte ich auch nicht. Also: Es käme nur eine reine Persönlichkeitswahl infrage, nicht die Spitzenkandidatur
Die Presse vermeldete sofort in reißerischen Schlagzeilen und mit großem Vergnügen, ich solle abgesägt werden. Während alte Parteifreunde mich für zu gemäßigt hielten, fand die „Qualitätspresse“ mich immer noch zu links und wollte mich abschießen. Es war eine typische Mediengeschichte, eine konstruierte „zweite Realität“; denn ich wusste aus internen Gesprächen: zahlreiche Mitglieder, die wie ich einen Ökologen auf Platz zwei wollten, würden mich auf den Plätzen vier, sechs oder acht, die allesamt sicher waren, wählen.
Bei der Wahl trat ich dennoch um den Platz zwei an, um deutlich zu machen, in welcher Spielklasse ich mich sah. Meine langweilige Rede war nicht auf Stimmungspunkte angelegt. Ich sprach über die Visa-Politik, eine kleine Provokation, weil Grünen dieses Thema für unwichtig hielten. Ein knappes halbes Jahr später sollte es zu einer heftigen politischen Kampagne gegen Rot-Grün führen. Reinhard Loske gewann die Wahl vor Volker Beck, den der starke Kreisverband Köln vorn sehen wollte. Den Wahlgang um Platz vier übersprang ich zu Gunsten von Beck. Für den Platz sechs hielt ich eine fulminante Rede und wurde mit großem Abstand gewählt. „Grüne Politik ist ein Dschungelkrieg“, sagte mir ein amerikanischer Beobachter und Vietnam-Veteran: „You are a survivor.“
In der grünen Fraktion übernahm ich unangefochten die Position des außenpolitischen Sprechers. Angeboten war mir auch die Koordinierung des außenpolitischen Arbeitskreises. Damit wäre ich Mitglied des Fraktionsvorstandes gewesen. Aus politischen und persönlichen Gründen lehnte ich zugunsten von Winfried Nachtwei ab.
Bundestagswahl 2005
Rufmord und Feigheit
2004/2005 wütete eine heftige politische Kampagne von CSU und CDU-Rechten gegen mich, unterstützt von einer konzertierten Medienkamarilla, wegen der Visa-Politik der Bundesregierung und einer kleinen privaten Beratertätigkeit, die ich begonnen hatte, um nicht auf Dauer vom Bundestagsmandat abhängig zu sein (allen voran Focus, Welt, Stern, Monitor). Ich hatte als Staatsminister die Reform der Vergabe von dreimonatigen Besucher-Visa, für die das Auswärtige Amt zuständig war, initiiert. Sie wurde nun verantwortlich gemacht für den massenhaften Missbrauch bei der Visa-Vergabe. Richtig war, dass es einen massenhaften Missbrauch gegeben hatte. Der „Volmer-Erlass“ aber war dafür nicht verantwortlich. Zudem hatte ich ihn zwar initiiert, aber kein einziges Wort formuliert. Meine Beratertätigkeit wurde in einer aberwitzigen Konstruktion damit in Verbindung gebracht. Letztlich handelte es sich einmal mehr um den Missbrauch der Ausländerfrage für innenpolitische Ziele, wie es die CDU/CSU gern vor wichtigen Wahlen praktiziert. Mein Vater war so empört über die Verleumdung seines Sohnes, dass er nach über 50 Jahren aus seiner CDU austreten wollte. Ich überzeugte ihn zu bleiben: “In der CDU muss es auch noch ein paar anständige Menschen geben.“ (siehe dazu das „Schlaglicht“ Visa-Untersuchungsausschuss sowie Essays unter Texte & Kontexte/Recht und Gesellschaft)
Gleichwohl, die Grünen in NRW begriffen mal wieder die Gefechtslage nicht, sondern ignorierten zunächst alles. Täglich aber prasselten, zwischen den „Qualitätsmedien“ koordinierte, negative Schlagzeilen auf die Kreisverbände nieder, die immer unruhiger wurden. Ich entkräftete Punkt für Punkt der Verleumdungen gegen mich in Schreiben an den Bundesvorstand und die Bundestagsfraktion. Die Vorstände baten, mich mit öffentlichen Stellungnahmen zurückzuhalten, sie selbst wollten mich verteidigen. Teil eins fand statt, Teil zwei nicht. Der NRW-Führung hatte ich angeboten, in Düsseldorf, intern oder auf einer Pressekonferenz, zu allen Anwürfen offensiv Stellung zu nehmen und sie zu widerlegen. Aber die Führung hatte Angst, dass ihr Wahlkampf für die anstehende Landtagswahl übertönt wurde. Bald war auch die grüne Bundesspitze in Sorge. Bundesvorsitzender Reinhard Bütikofer riet den NRW-Granden, „das Problem“, gemeint war ich, dezentral zu lösen, d.h. mich abzuschießen. Als erster legte mir Landesminister Michael Vesper, scheinbar fürsorglich, telefonisch den Rücktritt nahe, wovon auch immer („Versteh mich nicht falsch, aber wie lange willst Du Dir das noch antun…?“) Als der mediale Druck immer stärker wurde, lud mich die gesamte Landesspitze zu eben dem Gespräch vor, das ich Wochen zuvor angeboten, sie aber abgelehnt hatte. Wirklich interessiert war sie nur daran, dass ich durch Rücktritte den Druck reduzierte, am erbärmlichsten Landesministerin Bärbel Höhn unter vier Augen („Entweder Du trittst zurück oder ich fordere öffentlich Deinen Rücktritt!“). Ich fühlte mich von der Parteispitze ziemlich verraten und im Stich gelassen; um Druck von der Partei zu nehmen, legte ich jedoch das außenpolitische Sprecheramt nieder. Die Presse machte daraus selbstverständlich ein Schuldeingeständnis.
Im März 2005 war ich offiziell als Zeuge, inoffiziell als Angeklagter in den Untersuchungsausschuss zur „Visa-Affäre“ geladen. In der öffentlich im Fernsehen übertragenen acht-stündigen Vernehmung konnte ich alle Vorwürfe sachlich widerlegen. Der Ausschuss sprach mich in seinem Bericht anschließend ausdrücklich von jeder Schuld frei. Persönliche Entschuldigungen gab es keine. Journalisten, die mich in Grund und Boden geschrieben hatten, schleimten sich wieder ein und meinten, ich könne nach meinem Auftritt meiner Partei jede beliebige Rechnung stellen. Und jeden beliebigen Posten verlangen. Journalist: „Die Grünen brauchen jemanden wie Sie.“ Meine Antwort: „Das wissen die aber nicht.“
Ein zweites Gespräch, zu meiner Rehabilitation, nachdem nun die Dimension der Rufmordkampagne sichtbar geworden war, verweigerte die NRW-Spitze. Zu viele Leute sahen in der Kampagne der Rechten gegen mich Chancen für die eigene Karriere. In der Tat kamen einige von ihnen, nachdem sie ihre Landtagswahl durch horrende Fehler versemmelt hatten, kurz darauf in den Bundestag.
Landesliste 2005
Mein Kreisverband, der mich kannte und nie an mir gezweifelt hatte, hätte mich gern wieder aufgestellt. Doch meine Neigung, erneut für den Bundestag zu kandidieren, war gering geworden. Seit 25 Jahren fast war ich Profi in der Bundespolitik. Andere Interessen und Bedürfnisse meldeten sich immer deutlicher zu Wort. Zudem war absehbar, das Rot-Grün zu Ende ging, und eine weitere Periode auf der Oppositionsbank schien mir nicht sehr attraktiv, auch nicht ein Jahrzehntelanges Ausharren, um irgendwann vielleicht Außenminister werden zu können. Ich konnte mir das Gerangel um die wenigen verfügbaren Positionen gut vorstellen und auch die elenden Diskussionen über das Klein-Klein der Facharbeit und die strategischen Orientierungsfragen. Die Charakterlosigkeit der NRW-Granden kam hinzu. Zu all dem hatte ich keine große Lust mehr.
Vielleicht hätte ich es mir noch einmal anders überlegt, wenn ich richtigen Rückenwind aus der Partei gespürt hätte. Seit Jahren hatte ich keine Rede auf einem Parteitag mehr halten können. Mit einer solchen Rede hätte ich aus der Defensive, in die mich die Rufmordkampagne gedrückt hatte, herauskommen können. Plötzlich bot sich eine Gelegenheit. Spät abends rief mich Michael Kellner an, damals Referent der Bundesvorsitzenden Claudia Roth, später Generalsekretär der Partei. Er saß an einer Parteitagsrede für seine Chefin zum Thema Tschetschenien und kam damit nicht zurande. Er bot mir an: „Kannst Du die Rede nicht schreiben? Du kannst sie dann auch halten.“ Ich schrieb fast die ganze Nacht hindurch. Die Rede war gut, später wurden in Bundestagsdebatten lange Passagen zitiert. Sie bekam großen Beifall bei der grünen Versammlung. Sie wurde auch wortwörtlich gehalten, wie ich sie aufgeschrieben hatte. Nur nicht von mir. Roth hatte sie Kellner abgenommen und darauf bestanden, sie als Parteivorsitzende vorzutragen, auf den Glanz konnte sie nicht verzichten.
Das Ende
Kurz Zeit darauf stellte Bundeskanzler Schröder die Vertrauensfrage. Gegen seinen Willen sprach ich ihm das Vertrauen aus, verließ das Plenum des Deutschen Bundestages und war mir in diesem Moment bewusst, dass dies mein letzter Akt als Bundespolitiker war. Ich hatte eine Ära von Anfang bis Ende mitgestaltet. Darauf konnte ich stolz sein; aber nun reichte es. Ein Neubeginn konnte ohne mich stattfinden. Die NRW-Grünen hatten nicht einmal das Format, mich zu einem letzten demonstrativen Auftritt im Wahlkampf einzuladen. Danach bin ich zu keinem grünen Termin mehr gegangen, nicht in die Fraktion, nicht zu Parteitagen, nicht zu Jubiläumsfeiern, auch nicht zu meiner Verabschiedung. Blumen von den Feiglingen in Düsseldorf waren das letzte, was ich wollte. Das heißt, ich ging auch nicht zum Nominierungsparteitag für die nächste Landesliste in NRW. Meine politische Laufbahn war zu Ende. Ich verschwand einfach…