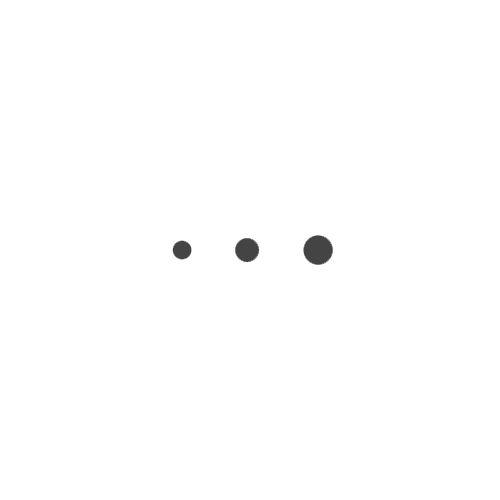(Buchbeitrag als Parteivorsitzender in: Karin Benz-Overhage, Wolfgang Jüttner, Horst Peter (Hrsg.), Zwischen Rätesozialismus und Reformprojekt, Lesebuch zum 70. Geburtstag von Peter von Oertzen, Köln 1994. Titel des Beitrags dort: Change now! Über Krise, Solidarität und rot-grün. Manuskript vom 09. Januar 1994; auszugsweise abgedruckt in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 4/1994)
Nun scheint auch Gerhard Schröder eine Große Koalition in Bonn zu wollen. Wie anders ist sein Kampf gegen Rot-Grün in Niedersachsen zu verstehen? Die absolute Mehrheit der Mandate wolle er in Hannover. Ob das Wahlvolk so leichtsinnig ist, diesem unberechenbar umtriebigen Mann, der heute U-Boote verkaufen und morgen eine neue Generation von Atomkraftwerken will, allein die Macht zu überlassen, werden wir sehen. Seine Botschaft heißt allerdings: rot-grün ist passé für die SPD.
Ähnlich sein Chef in Bonn. Er mag noch so sehr beteuern, dass er eine Große Koalition ausschließe. Den Willen zur Reform bedeutet das noch lange nicht. Und wenn es ihn politisch zu viel kostet, sich mit der Union ans Seil zu binden, so will er CDU-Politik auch mit den Liberalen durchsetzen. Nachdem die SPD sich im Asylstreit noch von den Konservativen nach rechts zerren ließ, will der Spitzenmann seiner Partei eine weitere Schmach dieser Art ersparen. Konsequenz: er geht freiwillig selbst nach rechts, bevor ihm Schäuble (Fraktionsvorsitzender von CDU/CSU) wieder ein Stöckchen hinhalten kann, über das er springen soll. Mehr noch: nachdem er seiner Partei einmal bedingungslose Gefolgschaft abgenötigt hat, treibt er die Rechtsdrift weiter. Er will die CDU in einem national-konservativen Ghetto einmauern und seiner Partei das liberal-konservative Spektrum sichern. In den Grundlinien der Außenpolitik gibt es zwischen ihm und der Regierung „keine wesentlichen Unterschiede“ (FR). Was Biedenkopf nicht schafft, scheint Scharping zu garantieren: eine modernisierte CDU-Politik – allerdings in Gestalt der SPD.
Manch ein Sozialdemokrat, dem die Richtung nicht geheuer ist, macht mit, weil der Vormann ein Winner-Typ ist. Aber was nutzt es den Reformkräften in der Republik, wenn nur die Elite ausgewechselt wird, die Politik aber dieselbe bleibt?
Keine Steuererhöhungen, Haushaltskonsolidierung, eine konzertierte Aktion, Konjunkturstimulierung. Dies sind die wirtschaftspolitischen Leitgedanken von Rudolf Scharping. In der Rhetorik wird noch mitgeschleppt, was die SPD seit Jahren aus grünen Programmen abgeschrieben hat. Im Kern aber gibt es einen Rückfall in die Rezepturen der siebziger Jahre. Nicht umsonst melden sich die alten Denkmäler Helmut Schmidt und Karl Schiller wieder zu Wort. Ihr Einfluss scheint wieder grösser zu sein als der der ökologischen Modernisierer. Weiter mit der Betonierung der Landschaft, Förderung des Autoverkehrs, Müllproduktion, Wachstumsideologie? Ökonomie vor Ökologie, um Arbeitsplätze zu retten? Es scheint so, aber nutzen wird es in der heutigen Krise wenig. Die alten Modelle lassen sich nicht beliebig wieder hervorkramen.
Das „Modell Deutschland“ ist am Ende
Das „Modell Deutschland“ ist am Ende. Trotz neuer Munterkeit werden es auch seine Erfinder Schmidt und Schiller so leicht nicht wiederbeleben können. Und das ist gut so. Das Modell lebte immer auf Kosten anderer. Seine aggressive Exportpolitik produzierte zwar eine übersteigert positive Außenhandelsbilanz – ein politischer Leistungsnachweis, mit dem die Bundesregierung hausieren gehen konnte. Doch die Beschwerden des Auslandes über das wachsende weltwirtschaftliche Ungleichgewicht wurden immer lauter. Insbesondere die weiter verarmende Dritte Welt hatte immer weniger Vergnügen an einer Entwicklungshilfe, die zunehmend die Absatzchancen deutscher Unternehmen fordern wollte. Völlig ausgeblendet wurde von den Dirigenten der konzertierten Aktion die Umweltbewegung als vierte Tarifpartei neben Staat, Arbeitgebern und Gewerkschaften. Sie saß nicht am Tisch, sondern bekam an den Bauzäunen in Wackersdorf und an der Startbahn West den Polizeiknüppel übergezogen.
Ein solches Modell musste scheitern. Die auf riskante Großtechnologien (Atomkraft) sich stützende pauschale Wachstumsorientierung stieß auf objektive technische Probleme. Die Diskussion über die Grenzen des Wachstums wurde ausgeblendet, der beginnende Wertewandel in der Gesellschaft nur als repressiv zu beantwortender Störfaktor wahrgenommen. Zwangsläufig vertiefte sich die politische und gesellschaftliche Desintegration. Am Ende stand mit der Gründung der GRÜNEN die Auflösung des Dreiparteiensystems.
Indem sie die gescheiterten Modelle von damals aufgreift, präsentiert sich die SPD heute als die Softie-Variante der aktuellen Regierungspolitik. Gegen Haushaltskonsolidierung ist ja nichts einzuwenden, solange es nicht die Sozialetats trifft. Will man die aber mitbelasten, warum überlässt man das dann nicht den konsequenteren Schwarz-Gelben, die weniger Skrupel haben, die Sozialstaatlichkeit aus dem Katalog der Verpflichtungen zu streichen? Auch gegen Konjunkturpolitik ist nichts zu sagen, solange sie nicht wieder in den alten Wachstumswahn auf Kosten der Umwelt zurückfällt. Wenn sie aber der goldene Hebel sein soll, wenn Deregulierung und betriebliche Renditeentwicklung die entscheidenden Zielmarken sind, warum darf dann nicht der jetzige Wirtschaftsminister weitermachen? Warum lassen die alten Herren nicht Helmut Kohl einen guten Mann sein, der ihre Konzepte rigoroser umsetzt, als sie selbst es könnten? Schließlich hat er das schon einmal getan, als er ihnen vor 12 Jahren die Macht abnahm, weil sie zu lange gefackelt hatten.
Wer aber nicht den fragwürdigen Mut hat, einen Brutal-Thatcherismus durchzusetzen, der das Ruhrgebiet zu einem Abziehbild Liverpools macht, der muss sich überlegen, ob er nicht einen grundsätzlich anderen Ansatz braucht. Im Jahre 1994 werden die Weichen gestellt: tiefer in die wachstumsorientierte, großtechnologiegestützte, entsolidarisierte Ellenbogengesellschaft oder Wende zur ökologisch-solidarischen Gesellschaft. Dazwischen gibt es nicht viel. Schröder und Scharping wollen den grundsätzlichen Richtungswechsel nicht. Sie signalisieren: Machtwechsel ja, Politikwechsel nein.
Eine Strategie für Reformpolitik in Bonn jedenfalls ist das nicht, was sie und die alten SPD-Zelebritäten auftischen. Höchstens ein Programm fürs Mitmachen in einer Großen Koalition, als Juniorpartner, der immer dann abfedert, wenn der Dicke es zu doll treibt und der ansonsten der neokonservativen Politik Unterstützung aus breiteren Schichten zutreibt. Oder als Basis für rot-gelb, wo man wieder klagen kann, dass die Liberalen sich als Bremser all der Reformen betätigen, die man selbst eigentlich auch nicht will. Dass die Ökologiepolitik in beiden Varianten wieder nur als Fußnote vorkommt, dürfte wohl ausgemacht sein. Aber ob so wenigstens die soziale Krise zu beheben ist?
Nichts spricht dafür. Sechs Millionen Arbeitslose in absehbarer Zeit, Massenarmut, Obdachlosigkeit – kann dies mit dem liberalen Mix von Konjunkturstimulierung, Deregulierung, Lohnzurückhaltung und Sozialabbau bewältigt werden? Und wenn diese Instrumente prinzipiell tauglich wären, wäre das Tempo der Verbesserung dann schneller als der Zerfallsprozess der Gesellschaft, ausgelöst durch Verarmung, verstärkt durch Angst und Perspektivlosigkeit und auf die Spitze getrieben durch Rechtsextremismus?
Auch eine höhere Staatsverschuldung hält Karl Schiller für vertretbar, auch wenn man sie heute der Regierung noch vorwirft. Schließlich könne die Jahrhundertaufgabe der Deutschen Einigung auf mehrere Generationen verteilt werden. Ja, was will man unseren Nachkommen denn noch alles aufhalsen? Haben unsere Kids nicht schon genug zu tragen an ihrer zweifelhaften Zukunft? Den Generationenvertrag hat die herrschende Generation der nachwachsenden längst einseitig aufgekündigt. Deren Biografien sind verbaut, ihre natürlichen Lebensgrundlagen werden weiter zerstört, sie müssen radioaktiven Müll en másse herumräumen, ob sie noch so viel Rente bekommen werden, wie sie heute einzahlen, darf bezweifelt werden. Nun sollen sie auch noch die Schulden für eine Politik übernehmen, über die sie nicht einmal mitbestimmen dürfen. Organisierte Verantwortungslosigkeit gegenüber den Nachwachsenden – oder nach mir die Sintflut, Hauptsache das nächste Wahlergebnis stimmt und die Zeit der (Wohl-)Lebenden ist nicht zu unkomfortabel.
Auch was den Aufbau Ost angeht, wird allgemeine Konjunkturpolitik mit den erhofften Sickereffekten nicht viel helfen. Wenn überhaupt etwas sickert, dann schwach und ungezielt. Die Massenverarmung aber wird weiterwachsen. Deren gesellschaftliche Kosten können auch die Neoliberalen nicht wegdefinieren. Wenn nicht über gezielten Aufbau durch eine ökologisch ausgerichtete regionale Strukturpolitik mit positiven Arbeitsmarkteffekten Perspektivlosigkeit abgebaut wird, werden dieselben Kosten fällig für einen Ausbau ordnungspolitisch-repressiver Organe. Schäubles Gruselutopie vom Einsatz der Bundeswehr im Inneren ist die letzte Konsequenz des sozial blinden Neoliberalismus.
Der Aufbau Ost kostet Geld. Geld wird gebraucht für den arbeitsplatzschaffenden ökologischen Umbau in den Infrastrukturbereichen Energie, Verkehr, Müll. Den Sozialstaat darf man nicht gerade dann abbauen, wenn er am nötigsten ist. Auch das wird teuer. Eine aktive Arbeitsmarktpolitik muss Arbeitszeitverkürzungen in großen Schritten flankieren. Das kostet. Wer sich vor der Frage, wie das Geld zu beschaffen ist, herumdrückt, indem er in die Wachstumsträume der Siebziger zurückfließt, der demonstriert die Bereitschaft, deutsche Gemütlichkeit zu pflegen, nicht aber den Willen, die Probleme wirklich anzupacken.
Die Wachstumsideologie, die Schiller und Strauss im Stabilitäts- und Wachstumsgesetz von 1967 formuliert haben, ist überholt. Statt pauschaler Wachstumsförderung brauchen wir eine gezielte, sozial abgefederte ökologische Modernisierungspolitik, differenziert nach Branchen und Regionen. Für einige bedeutet das unter dem Strich Wachstum, für andere Schrumpfung. Der Begriff des Wachstums muss ersetzt werden durch den des ökologischen Gleichgewichts. Konjunkturpolitik ist dennoch möglich; Umwelttechnik ist die wichtigste Wachstumsbranche.
Quasi religiöse Bekenntnisse zur Marktwirtschaft sind nichts wert. Der Kapitalismus hat im Systemvergleich die zentralstaatliche Kommandowirtschaft besiegt. Keine Volkswirtschaft kann ohne funktionierende Märkte auskommen. Das ist richtig. Der Markt aber hat sich als unfähig herausgestellt, den Aufbau Ost zu organisieren, soziale Gerechtigkeit herzustellen und die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten. Ein Begriffsstreit über die vorgeschalteten Adjektive sozial und ökologisch ist müßig. Welchen Charakter etwa tragen die Ökosteuern, die wir fordern? Beweisen sie die Vitalität der Marktwirtschaft, weil sie marktkonforme Steuerungsmittel sind? Oder sind sie Symbole des Staatsinterventionismus?
Statt über Ideologien sollte über den richtigen Politik-Mix diskutiert werden. Und darüber, wie die finanziellen Mittel aufgebracht werden können. Aufbau Ost, Abbau der Arbeitslosigkeit, ökologischer Umbau der Infrastruktur – das alles kann nicht aus der Portokasse bezahlt werden. Wenn hohe Wachstumsraten weder zu erwarten noch wünschenswert sind, muss die Politik sich das Geld dort holen, wo es ungenutzt auf Halde liegt. Die trotz Rezession hohe Liquidität in der deutschen Wirtschaft gilt es zu mobilisieren, wie es Ludwig Erhard in den fünfziger Jahren mit einer Investitionshilfeabgabe praktiziert hat. Die jährlich 200 Mrd. DM Kapitalerträge bei den privaten Haushalten – nicht zuletzt Ergebnis der Staatsverschuldung – müssen angezapft werden, anstatt wieder den kleinen Leuten in die leere Tasche zu greifen. 200 Mrd.DM werden in diesem Jahrzehnt jährlich aus Erbschaften an Personen fließen, die für diese Gnade der Geburt keine Leistung erbracht haben. Das Aufkommen aus der Erbschaftssteuer ist im internationalen Vergleich eine Bagatelle: ein feudales Relikt im Kapitalismus – wie der liberale Ökonom Wilhelm Hankel moniert. Riesiger Reichtum liegt im Grundbesitz, als Altlast des Mittelalters für die Einkommen von mehr als 10 Millionen DM! Soviel, dass damit zu einem Drittel die soziale Grundsicherung finanziert werden kann, mit der wir die alte Sozialhilfe ablösen wollen. Das Monopoly-Spiel von Konzentration und Verarmung muss abgebrochen werden.
Nichts gegen Wohlstand, aber es gibt einfach stinkreiche Leute. Sie sind, so sie ihr Vermögen nicht der sozialen Verpflichtung unterwerfen, die das Grundgesetz vorsieht, die dissozialen Aussteiger dieser Gesellschaft. Selbst als Marktgänger der gehobenen Nippes-Industrie von Porsche bis Rolex sind ihre investiven Inputs gering. Letztlich sind sie Spieler mit freivagabundierendem Kapital, ob am Roulette-Tisch oder den Xeno-Märkten, das sich auf der rein monetären Ebene bewegt. Warum stellt sich die Finanzpolitik nicht endlich der Aufgabe, die monetäre Akkumulation, die sich von der realen immer weiter abkoppelt, auf die produktive Ebene zurückzuführen? Das Argument der Kapitalflucht ist nicht von der Hand zu weisen. Aber warum wird die EU nicht endlich genutzt, um zumindest in Europa zu einer Harmonisierung auf hohem Niveau zu kommen. Warum muss Luxemburg Fluchtburg sein dürfen?
Der Solidarpakt der großen Parteien hat nicht zum Ziel, die längst überfällige Umverteilung von oben nach unten zu organisieren. Er verschiebt die Lasten ein wenig zwischen den schwächeren, mittleren und öffentlichen Haushalten. Solidarität, vielleicht verzichtbar für die Wirtschaft, aber unverzichtbar für jede Zivilisation, muss anders ansetzen. Die Gesellschaft muss die Kraft aufbringen, denen einen wirklichen Solidarbeitrag abzutrotzen, die es dicke sitzen haben.
Sozial-ökologischer New Deal
Die Zweidrittelgesellschaft von oben muss ersetzt werden durch einen Solidarzusammenhang von unten. Wir brauchen einen ökologisch-solidarischen Gesellschaftsvertrag. Er kann die Kräfte bündeln, die ein fundamentales Reforminteresse haben: die ökologisch bewussten, die sozial benachteiligten und die patriarchal unterdrückten.
Dazu eine kurze Skizze.
Raffsucht gilt immer noch als normal. Allein deshalb, weil sie dem Marktgeschehen innewohnt. Ethische Korrektive, wie sie die christlichen Sozialausschüsse anwenden wollten, wurden immer wirkungsloser. Aber es gibt neue Bewegung. Das ökologische Bewusstsein, dass sich seit 20 Jahren entwickelt hat, bleibt nicht mehr nur im Raum unverbindlicher Einstellungen.
Es hat sich in Teilen der Mittelschichten längst zu einer harten postmateriellen Interessenorientierung verdichtet. Viele aufgeklärte Menschen mit höherem Bildungsabschluss und entsprechenden Berufspositionen haben die traditionelle Aufstiegsmentalität hinter sich gelassen. Ihnen genügt weitgehend der erreichte materielle Wohlstand. Was sie wollen, ist weniger Stress, mehr Freizeit, mehr Muße, weniger Konkurrenz und Hetze, mehr Lebensgenuss. Wachstum als wichtigste ökonomische Zielgröße macht vor diesem Wertehintergrund keinen Sinn mehr. Das Bewusstsein, dass jede mehr verdiente Mark mit dem Verlust von Lebenswelt, mit der Zerstörung dessen, was mensch Genießen möchte, erkauft werden muss, macht materielle Wohlstandssteigerung immer fragwürdiger. Hinzu kommt das aktuell schlechte Gewissen. Ungeschoren zu bleiben, während die Armen weiter bluten müssen, das zerstört auf Dauer das soziale Selbstbild.
Für ein Drittel der Gesellschaft – im Westen vielleicht weniger, im Osten deutlich mehr – steht nach wie vor die soziale Frage im Vordergrund. Es gibt objektiven Nachholbedarf. Die Forderungen nach Verteilungsgerechtigkeit, nach Verbesserung der Lebenschancen, nach Abbau struktureller Armut, nach eigenständiger ökonomischer Existenzfähigkeit der Frauen stellen sich wieder dringlicher. Zwar sind auch breite Teile der ärmeren Schichten sensibilisiert für ökologische Probleme. Solange sie aber den täglichen Kampf um Arbeit und Brot zu führen haben, fallen sie als Bündnispartnerinnen für eine Ökologisierung der Gesellschaft aus.
Wenn das untere Drittel und der ökologisch und sozial sensibilisierte Teil der Mittelschichten – und in ihnen in besonderer Weise die Frauen – das markanteste Interesse an grundlegenden Änderungen von Gesellschaftsstruktur und Lebensweise verspüren, dann ist es Aufgabe von Reformpolitik, einen solchen Interessenausgleich zwischen diesen Kräften zu organisieren, dass sie gemeinsam ein Bündnis für eine Strategie grundlegender Reformen zu bilden bereit sind.
Deshalb schlagen wir zur Überwindung der Krise einen New Deal vor: ein sozialökologisches Umverteilungsprojekt. Der Verzicht der Neuen Mittelschichten auf weiteren materiellen Zuwachs kann ökologische und soziale Umbauprozesse finanzieren, die gleichermaßen die soziale Lebenslage der armen Schichten verbessern und allen ein Mehr an ökologischer Lebensqualität bieten. Die Ärmeren, die in den Genuss neuer sozialer Programme kommen, könnten ihrerseits, vom unmittelbaren Alltagsdruck entlastet, sich für die Ökologisierung der Gesellschaft miteinsetzen. Doch auch bei den aufgeklärten Mittelschichten – von der Oberstudienrätin bis zum promovierten Taxifahrer – gibt es Grenzen der Belastbarkeit. Alleiniges Ziel ist deshalb nicht die Umverteilung aus der Mitte nach unten. Der Deal wirkt als Medium zur Bildung einer politischen Kraft, die dem oberen Drittel der Einkommens- und Vermögenspyramide durch die Abschöpfung überschüssigen Reichtums einen wirklichen Solidarbeitrag abtrotzen könnte.
Praktisch bedeutet das: Arbeit, Einkommen und Lebenschancen müssen umverteilt werden. Nur eine drastische Arbeitszeitverkürzung wird in der Lage sein, die in Kürze zu erwartende Arbeitslosenzahl von 6 Millionen abzubauen. Dass dies nicht mit vollem Lohnausgleich für mittlere und höhere Einkommen verbunden sein kann, muss nicht als Verlust einer angenehmen Lebensperspektive verstanden werden. Die unteren Einkommen dürfen nicht weiter belastet werden. Darüber aber gibt es Spielraum.
Weniger Arbeit wird die Reproduktionsbedürfnisse und damit die Freizeitgewohnheiten derart verändern, dass ganz andere Bedürfnisse sich Bahn brechen. Kultur und Natur zu genießen, muss nicht viel kosten – so es sie noch gibt. Eine intakte Natur und vielfältige Kultur erscheinen geradezu als Voraussetzung für die Bereitschaft, auf Mehrarbeit und Geld zu verzichten.
Die Vision von den veränderten Lebensstilen kann nicht länger als Spinnkram der Ökobewegung, als ungespülte Kaffeetasse auf dem WG-Küchentisch abgetan werden. Heute, wo die Ökos die enterotisierende Wirkung der Wollsockigkeit längst abgelegt haben, sollte man einen neuen Blick auf den Entwurf des „Anders leben“ werfen. Und man wird sehen, dass das, was vom ökologischen Wunsch zum ökonomischen Zwang geworden ist, viel Attraktivität aufweist.
Hier finden sich Lebensentwürfe jenseits von Karrierismus und Machotum. Sie sind als neuer Maßstab, als politikleitende Ideen unabweisbar.
Die amerikanische Kommunitarismus-Bewegung unterstreicht dies eindrucksvoll. Wo die öffentliche Hand trotz besten Willens kommunale Aufgaben nicht mehr erfüllen kann, tritt eine neue Form von Selbsthilfe auf den Plan. Die Bildung von Nachbarschaften, die selbstregulierend staatliche Aufgaben in die Gesellschaft zurückholen, verbunden mit Emanzipationsprozessen und der Erfüllung persönlicher Kommunikationsbedürfnisse, können geradezu zu einer Neufundierung der Demokratie von unten führen.
Der nötige Interessenausgleich zwischen Nord und Süd, West und Ost im Rahmen einer ökologisch-solidarischen Weltwirtschaft bringt einen weiteren Beweis. Eine Anpassung aller Lebensverhältnisse an die Konsumstandards des kapitalistisch-industriellen Westens wird es nicht geben können. Deshalb müssen die Maßstäbe für Wohlstand neu definiert werden. Der Vorschlag des New Deal beinhaltet dies. Lebensqualität kann oberhalb einer Grundsicherung nicht primär materiell bestimmt werden. Das gilt auch als Maßstab für die Herstellung der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland.
Nur auf der Basis eines neuen Gesellschaftsentwurfs, der im klaren Kontrast zur neoliberalen Austeritäts-Politik steht, wird sich mittelfristig eine neue politische Reformkoalition im Bund halten können. Denn nur ein solcher Entwurf bietet einen Maßstab, mit dem man zwischenparteiliche Kompromisse als Fortschritt oder Blockade bewerten kann.
Postmaterialismus in den Parteien?
Alle Untersuchungen zeigen, dass die ökologisch und sozial aufgeklärten Mittelschichten Sympathie für grüne Politik haben. Bündnis 90/Die Grünen finden in diesem Sektor der Gesellschaft den größten Rückhalt. Wir sind bereit, auch im Wahlkampf offen zu sagen: Wir können „unserer“ Klientel angesichts der Krise keine weitere Wohlstandssteigerung versprechen. Und wir möchten, dass dies auch die anderen Parteien mit „ihren“ Leuten tun. Alle gemeinsam aber müssen die Massenarmut bekämpfen.
Auch in anderen Parteien gibt es postmaterielle Einstellungen. Ob deshalb aber ein Reformbündnis quer zu den Parteien möglich ist, scheint mehr als zweifelhaft.
Die meisten Anhängerinnen des politischen Liberalismus haben die FDP bereits Richtung grün verlassen. An den hemmungslos Wirtschaftsliberalen haben wir kein Interesse. Die Sozialausschüsse in der CDU haben nicht die geringste Chance, die Union von innen her zu reformieren. Ihre objektive Funktion liegt nur noch darin, unter dem Zeichen des Kreuzes der unchristlichsten Politik Gutgläubige zuzuführen. Da sei der Herr vor.
Die PDS hat zwar auch aus grünen Programmen abgeschrieben. Ihre Mischung aus Altlasten, Linkspopulismus und Heimatverein aber wirkt irgendwie gespenstisch. Und das ist auch ihre Funktion. Jede Stimme für die PDS wäre eine Stimme gegen den rot-grünen Wechsel in Bonn.
Bleibt die SPD. Hier hat die postmaterielle Grundhaltung ein gewisses Terrain. Noch aber befindet sie sich in der Minderheit gegenüber den materiellen Klientelinteressen aller Gruppen. Der Klientelismus wird durch den grünen Diskursdruck in Schranken gehalten, nutzt aber in aggressiver Weise jede Gelegenheit zum Durchbruch. Dabei werden auch die umweltpolitischen Ansätze wieder zur Disposition gestellt. Verstärkt wird dieser Effekt dort, wo die SPD-Regierungspolitik betreibt, vergleiche Hannover. Von daher hat die SPD kein umfassendes und zusammenhängendes Konzept ökologischer Umverteilung. Es existieren umweltpolitische Programmpunkte und gleichzeitig der Glaube an einen kaum gebremsten industriellen Produktivismus. Die nachsorgende Umwelttechnik der SPD ist fast das Gegenprojekt zur Politischen Ökologie von Bündnis 90/Die Grünen. Die ökologischen Ansätze auf dem linken SPD-Flügel werden sich nur entfalten können, wenn sie in Verhandlungen eine Scharnierfunktion bekommen.
Die historischen, kulturellen und konzeptionellen Unterschiede von Bündnis 90/Die Grünen und der Sozialdemokratie galten bisher immer als strategisches Dilemma. Wollte die SPD sich uns Alternativen nähern, wurde die Voraussetzung für Verhandlungen, die gemeinsame Mehrheit, zerstört. Das war die Strategie von Lafontaine 1990, als er uns unter die 5 % drückte und in der politischen Mitte an die Union verlor. Wenn die SPD aber ins konservative Lager hineinmanövriert wie heute, wird eine Koalitionsbildung mit uns aus inhaltlichen Gründen schwierig.
Lohnt es sich dann überhaupt noch, über rot-grün nachzudenken? Die Skepsis ist angebracht. Aber sollen wir untätig zusehen, wie die SPD sich auf eine schwarz- oder gelb-rote Regierung einstellt und tapfer das Fähnchen der Opposition hochhalten?