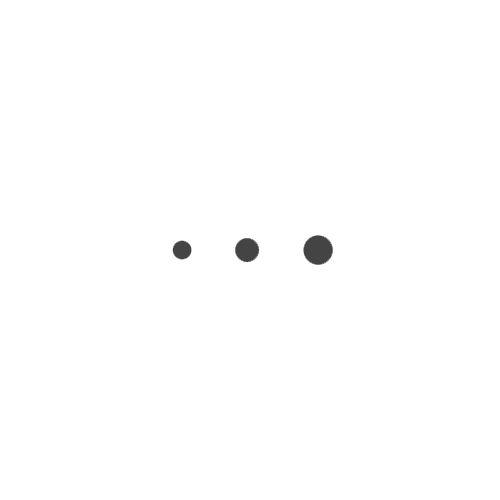(Verfasst anlässlich der Diskussion bei Friedensbewegten über militärische Maßnahmen gegen den Terrorismus des 11.9.2001. Erschienen in der FR, 07. Januar 2002, Dokumentation; nachgedruckt in Schulbüchern und Lehrmaterialien der Fern-Uni Hagen. Der Text wurde heftig diskutiert und brachte mir anfangs zahlreiche Anfeindungen ein. Später verstanden die Kritiker, dass ich angesichts einer neuen Bedrohungslage das Erbe der Friedensbewegung nicht abschaffen, sondern möglichst viel davon retten wollte)
Pazifismus und Gewissen – sie sind letzte Berufungsinstanz für alle, die eine deutsche Beteiligung an den militärischen Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus ablehnen. Ein solcher Pazifismus setzt sich als universelle Ethik, an deren Ansprüchen der Pragmatismus jeder Regierung scheitert. Aber: Kann die pazifistische Gesinnung diesen Absolutheitsanspruch mit Recht erheben? Oder drücken sich nicht viele, die sich Pazifisten nennen, vor der Verpflichtung, die politische Bedingtheit ihrer Grundeinstellung zu bedenken und zur Debatte zu stellen?
Das biblische Tötungsverbot muss gewiss die ethische Grundlage allen politischen Handelns bilden. Religionsgemeinschaften legen es zugrunde, wenn sie ethische Leitlinien für den Waffengebrauch aufstellen. Doch sie wissen, dass Ethik nicht in eine einzige Handlungsmoral zu übersetzen ist. Das tun nur religiöse Fundamentalisten. Wer keinen Gottesstaat will, lässt der Politik die Freiheit der Entscheidung, mahnt jedoch zu einem abgewogenen Urteil. Gerade indem die Kirchen sich als außer-politische Instanz begreifen, erfüllen sie ihre normative Aufgabe. Innerhalb des Politischen ist ein abstrakt-gesinnungsethischer Pazifismus handlungsunfähig.
Anders der politische Pazifismus. Er ist normengeleitet, aber er ist sich gleichermaßen seiner historischen Bedingtheit bewusst. Jede Zeit hat ihre eigenen Bedrohungen und Feindbilder. Der politische Pazifismus wendet sich nicht nur gegen falsche Feindbilder, sondern beansprucht auch, Antworten auf die Bedrohung selbst zu bieten. Die pazifistische Konsequenz der einen Zeit gibt nicht unbedingt plausible Antworten auf die Bedrohungen einer anderen.
Der politische Pazifismus der frühen Sozialisten, der sich gegen das Tschingderassabum eines nationalstaatlichen Imponiergehabes wehrte, hatte sein Recht. Die armen Schlucker der Arbeiterklasse mochten das Gefühl gehabt haben, für die Expansionsinteressen hoher Herren verheizt zu werden. Aber sind solche Motive heute noch triftig? Im Proletkult der DDR und der Neuen Linken Westdeutschlands kam diese Stimmung auch nach dem 2. Weltkrieg wieder hoch. Aber sie verschwand, wie auch der heroische Auftrag der Arbeiterklasse zur Bildung einer neuen Gesellschaft an Überzeugungskraft verlor. In den Zeiten moderner Demokratien hat der klassenkämpferische Pazifismus ausgedient.
„Nie wieder Auschwitz, Nie wieder Krieg!“ So lautete die pazifistische Konsequenz aus den Erfahrungen mit Nationalsozialismus, Antisemitismus und Militarismus. Diese Haltung der Nachkriegszeit, die Protestbewegungen bis in die späten sechziger Jahre hinein prägte, war ein epochaler Fortschritt. Selbst wenn dieser strenge „Ohne mich“-Pazifismus in der Minderheit blieb, so wurde er doch in gemäßigter Form zur Grundhaltung der Nachkriegsgenerationen. Aber im Laufe der Zeit verschwand die aus der jüngsten Geschichte herrührende Angst vor den Deutschen. Das deutsche Ansehen in der Welt wuchs, gerade auch wegen der militärischen Zurückhaltung und des Selbstverständnisses als zivile Macht.
Auch dieser Nachkriegspazifismus der fünfziger und sechziger Jahre gibt keine Antwort mehr auf heutige Fragen. Mehr noch, der Kosovo-Krieg hat gezeigt, dass die pazifistischen Postulate „Nie wieder Krieg, Nie wieder Auschwitz“, nur noch schwer zu vermitteln waren: Wer den Antimilitarismus retten wollte, musste das faschistische und völkermörderische Treiben gegen die Kosovo-Albaner hinnehmen. Wer ethnische Säuberungen als Konsequenz aus der faschistischen Vergangenheit verhindern wollte, musste Ja sagen zu einem bedingten Militäreinsatz.
In den siebziger Jahren speiste sich der Pazifismus als Folge des Vietnamkrieges aus anti-imperialistischen Motiven. Für eine Politik der Industriestaaten gegen die Entwicklungsländer, für den Kampf gegen Befreiungsbewegungen wollten viele Menschen nicht zu den Waffen greifen. Auch dieser Pazifismus hatte gute Gründe, gibt aber keine Antwort auf heutige Fragen. Das militärische Eingreifen der Allianz gegen den Terror in Afghanistan dient nicht der Unterdrückung des afghanischen Volkes, sondern seiner Befreiung. Nicht Knechtung ist das Ziel, sondern Emanzipation. Nicht Rohstoffinteressen sind bestimmend, sondern Verteidigung gegen neue terroristische Angriffe. Gegen ein Sendungsbewusstsein, das sich zum massenmörderischen Wahn gesteigert hat, helfen meist keine Verhandlungen. Notfalls muss es niedergerungen werden. Dafür gibt es Beispiele in der Dritten Welt selbst: erst der Einmarsch der Vietnamesen in Kambodscha legte den Roten Khmer das blutige Handwerk und erst die Intervention Tansanias stoppte den Massenmörder Idi Amin in Uganda.
Überlebt hat sich auch der in den achtziger Jahren entwickelte Nuklear-Pazifismus. Die Konfrontation zweier hochgerüsteter Militärblöcke, die nukleare Abschreckungsstrategie, die Gefahr, dass mutwillig oder fahrlässig der atomare Holocaust ausgelöst werden könnte, trieb Hunderttausende auf die Straßen. Auch dieser Pazifismus, die „neue Friedensbewegung“, war legitim, gibt aber keine Antwort auf heutige Fragen. Die Kontrolle und Abrüstung von Massenvernichtungswaffen bleiben als wichtige Aufgaben bestehen, auch wenn die Zuspitzung der achtziger Jahre durch die Auflösung des Warschauer Paktes, die START-Verträge und die Annäherung von NATO und Russland beseitigt wurde. Massenvernichtungswaffen in den Händen von Terroristen – das ist die neue Gefahr, eine reale, nicht nur ein falsches Feindbild. Die Parole „Kampf dem Atomtod“ wird Al Quaida wenig beeindruckt haben.
Die aufgelöste Blockstruktur hinterließ ein Vakuum. Die Großorganisationen beeilten sich, sich als Ordnungsmacht auf dem politischen Markt anzubieten und als Garanten einer neuen Friedensordnung darzustellen. Der Pazifismus der neunziger Jahre versuchte nunmehr, OSZE und EU gegenüber der Militärorganisation NATO stärker zur Geltung zu bringen. Er wollte die NATO in eine – stärker nichtmilitärische – Sicherheitsstruktur auflösen, die die ehemaligen Feindmächte von Vancouver bis Wladiwostok umfasste. Auch dieser Pazifismus hatte politische Perspektiven, die keine Antwort auf die neue Bedrohung geben. Inzwischen nähern sich bei der Bekämpfung des Terrorismus die ehemaligen Blockvormächte USA und Russland, ebenso ihre ehemaligen Verbündeten und Satelliten, in einer Art und Weise an, wie die Vertreter einer gesamteuropäischen Sicherheitsgemeinschaft es sich immer gewünscht hatten.
Das neue Jahrhundert begann mit einer neuen Bedrohung, einem neuen Feind. Für Pazifisten waren Feinde oft nur Projektionen, Vorwände derer, die aus Eigeninteresse – Macht, Geld – Krieg führen wollten. Das Eintreten gegen Feindbilder war deshalb eine der vornehmsten Aufgaben des Pazifismus. Doch heute gilt: es gibt nicht nur eingebildete Feindbilder, es gibt auch wirkliche Feinde, Feinde, die nicht in den Kategorien zwischenstaatlicher Konflikte zu fassen sind. Nicht mehr Staaten und Völker kämpfen gegeneinander, nicht mehr Blöcke rüsten auf. Mit extremer verbrecherischer Energie kämpft eine international vernetzte Nichtregierungsorganisation gegen die moderne globalisierte Welt. Eine verbrecherische Schattengesellschaft will die Grundlagen der Moderne unterminieren. Diese „privatisierte Gewalt“ (Eppler) ist nicht als falsches Feindbild abzutun.
Doch es ist verblüffend, welche Verdrängungsleistung manche Pazifisten aufbringen, um das bisherige Weltbild gegen neue Erkenntnisse abzuschotten. Erst wollen sie die Anschläge in New York und Washington nicht als bewaffneten Angriff begreifen. Dann wird – das Verblassen der schockierenden Bilder und die allgemeine Verdrängung nutzend – der kritische Blick auf die gerichtet, die den aktiven Kampf gegen den Terror aufnehmen. Man lehnt sich zurück und kritisiert die Strategie, prangert die an, die beim Kampf gegen den Terror auch Unschuldige treffen. Unversehens werden antiimperialistische Muster neu aufgelegt – Opfer zu Tätern erklärt. So erübrigt sich auch die Antwort auf die Frage nach der besseren Strategie.
Ein Pazifismus, der als politische Kraft ernstgenommen werden will, darf nicht die Realitäten verdrängen, um ein Weltbild zu retten. Er darf nicht nur die anderen kritisieren, er muss selbst Antworten geben. Frühere Pazifisten haben dies versucht. Die Nuklearpazifisten forderten Abrüstung und Auflösung der Militärblöcke – eine Kritik an der geltenden Sicherheitspolitik, aber zugleich die – umstrittene – Antwort auf die zugrunde liegende Bedrohung. Der Pazifismus der neunziger Jahre kritisierte nicht nur das Revival der NATO, er entwickelte die Idee einer gesamteuropäischen Sicherheitsgemeinschaft. Heute ist eine Antwort auf die „privatisierte Gewalt“ verlangt. Wer redlich argumentiert, wird zugeben, dass militärische Mittel allein die Terroristen nicht in die Knie zwingen werden. Umgekehrt aber können nichtmilitärische Mittel allein dieses Ziel ebenso wenig erreichen.
Zudem erwartet die internationale Gemeinschaft längst einen deutschen Beitrag, auch militärischer Art, zur Lösung regionaler und globaler Konflikte. Aber weiterhin gilt: Deutschland darf nicht dominant auftreten, das große Land im Zentrum Europas muss eingebunden bleiben in internationale Strukturen. Selbsteinbindung und Selbstbeschränkung, dies sind zwei Leitlinien einer deutschen Außenpolitik, die Nachbarn die Sorge nimmt – vor deutscher Aggressivität und vor deutscher Verweigerung. Militärische Machtprojektion um politischer Ziele willen – solche Drohgebärden konservativer Nationalstaatlichkeit wollen unsere Nachbarn nicht mehr erleben. Aber Verunsicherung und Befremden verursachen die Deutschen auch, wenn sie sich zwar einbinden in internationale Organisationen, die dort getroffenen Entscheidungen aber selbst nicht umsetzen wollen, mit Rücksicht auf die verbrecherische Geschichte. So entsteht der Verdacht, sie wollten sich hinter der Geschichte verstecken und anderen die Lasten aufbürden.
in Pazifismus, der bewaffnete Gewalt minimieren will, hat eine wichtige Aufgabe: die Rolle des Militärischen zurückzudrängen und dafür zu sorgen, dass nicht unter dem Vorwand der terroristischen Gefahr militärische Mittel für ganz andere Ziele eingesetzt werden. Politischer Pazifismus heute heißt: Einsatz für das Primat der Politik und die Unterordnung militärischer Schritte unter politische Strategien, für die zentrale Rolle der Vereinten Nationen, die Geltung des humanitären Kriegsvölkerrechts und die Verhältnismäßigkeit der Mittel, für humanitäre Hilfe und Menschenrechte, für Auswärtige Kulturpolitik und den Dialog der Kulturen, für Entwicklungshilfe und Institutionenbildung, für global governance und eine internationale Strukturpolitik, die auf globale Gerechtigkeit zielt. Pazifismus heute kann militärische Gewalt als ultima ratio, als letztes Mittel, nicht leugnen, kämpft aber für die prima ratio, die zivilen Mittel der Krisenprävention. Der Ort eines so verstandenen politischen Pazifismus ist nicht das politische Niemandsland. Auch nicht der des folgenlosen Protestes. Es gilt, Verantwortung und Risiken mitzutragen.
Beim Kampf gegen den Terror hat die internationale Staatengemeinschaft, legitimiert durch die UNO, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ansatzweise im Sinne einer Weltinnenpolitik gehandelt. Der 11. September hat diese neue Epoche eingeleitet. Noch ist der Wandel nicht perfekt. Noch ist das Völkerrecht um die Gestalt des zwischenstaatlichen Konfliktes konstruiert, muss „privatisierte Gewalt“ territorialstaatlich zuordnen. Erst in Ansätzen ist auch in der Sicherheitspolitik Globalisierung zu erkennen, die in Wirtschaft und Umweltfragen längst unser Bewusstsein bestimmt. Doch war es nicht Weltinnenpolitik, was Pazifisten wollten? Wer realistischerweise nicht erwartete, dass Gewaltkonflikte plötzlich verschwinden, konnte nur hoffen, dass sie in rechtlichen Bahnen bewältigt würden, die zunehmend stärker den Maximen der Innenpolitik demokratischer Staaten folgten.
Die USA, verdächtigt, die UNO zu schneiden, eigene Interessen unilateral zu verfolgen und sich zu wenig um globale Fragen zu scheren, entdecken inzwischen, dass sie Freunde brauchen und liebäugeln wieder mit dem Multilateralismus. In der Tat, vielleicht nur aus der Not geboren. Russland und China orientieren sich neu in der Sicherheitspolitik. Sicherlich nicht uneigennützig. Doch gerade jetzt wäre es doch Aufgabe der Pazifisten, statt dies ideologiekritisch zu denunzieren, die Chance zu nutzen. Gerade jetzt muss eine multilaterale Weltordnungspolitik gegenüber unilateraler Supermachtpolitik gestärkt werden. Gerade jetzt verlangt die schwierige Beziehung der islamisch-arabischen Welt mit dem Westen den von Pazifisten seit langem geforderten interkulturellen Dialog. Noch nie waren die Aussichten so groß, dass sich die internationale Staatengemeinschaft auf Methoden zur Krisenprävention und zivilen Konfliktbearbeitung verständigt. Die Bundesregierung hat ihre eigenen Mittel dafür energisch ausgebaut.
Die Perspektive einer Weltinnenpolitik, so undeutlich sie noch sein mag, bietet auch die Chance zur Versöhnung verschiedener außenpolitischer Denkschulen. Der klassische Realismus, der nur eine anarchische Konkurrenz von Nationalstaaten kannte, die mit allen Mitteln zu ihrem jeweiligen Vorteil arbeiten, hat rapide an Boden verloren. Langsam haben sich sogenannte institutionelle Ideen als Leitmotive internationaler Politik durchgesetzt: es nützt dem eigenen Staat, wenn er sich in regionale Bündnisse einbindet. Es dient dem eigenen Sicherheitsinteresse und dem Schutzbedürfnis der Partner. Die Terroranschläge waren Anlass, dieses Denken auf die globale Ebene zu übertragen. In der Weltinnenpolitik treffen sich die Gedanken der etablierten Außenpolitik und eines neuen politischen Pazifismus. Sollen die alten Pazifisten ausgerechnet jetzt aus der Politik aussteigen, nur weil militärische Mittel nicht ganz verzichtbar sind?