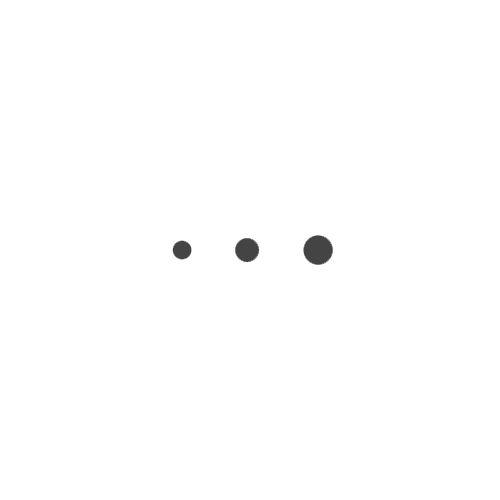(erschienen in: Gawrich, Andrea, Lietzmann, Hans J. (Hg.), Politik und Geschichte, “Gute Politik” und ihre Zeit, Festschrift für Wilhelm Bleek, Münster 2005; unter Mitarbeit von Lars Brozus)
Außen- und Sicherheitspolitik im Zeitalter der Globalisierung
Zu den wichtigsten Aufgaben staatlicher Daseinsvorsorge gehört die Gewährleistung von Sicherheit. Dies gilt nach innen wie nach außen. Dabei unterscheiden sich Innenpolitik und Außenpolitik systematisch an einem Merkmal: Innenpolitik findet in einem hierarchisch strukturierten Ordnungsrahmen statt. Hierarchie heißt dabei im Idealfall nicht Subordination oder gar Recht des Stärkeren. Im Gegenteil zeichnet sich der moderne demokratische Rechtsstaat durch weitgehende Partizipationsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger aus. Staatliche Willkür ist durch eine stabile Rechtsordnung eingehegt. Der so begrenzte Staat sichert durch das ihm eigene Gewaltmonopol die Abwesenheit des Bürgerkrieges. Damit wird Sicherheit im Inneren gewährleistet.
Außenpolitik hingegen ist durch die Abwesenheit einer institutionalisierten Ordnung gekennzeichnet. Es gibt keine Weltregierung, die befugt und fähig wäre, Anordnungen durchzusetzen. Im internationalen Raum spielen Machtinstrumente in Abwesenheit einer allgemein akzeptierten, verlässlichen Rechtsordnung daher in der Tendenz eine größere Rolle als in der Innenpolitik. In der anarchisch strukturierten internationalen Politik scheint ihr Einsatz oft verführerisch, um politische Ziele auch gegen den Willen anderer zu erreichen. Sicherheit nach Außen wird entsprechend in historischer Perspektive typischerweise über Macht produziert. Großmächten gelingt dies aus eigener Anstrengung, andere Staaten sind darauf angewiesen, sich zu verbünden und sich auf geliehene Macht zu stützen – mit allen daraus resultierenden Kosten, Unwägbarkeiten und erzwungenen Souveränitätseinschränkungen.
Die Unterscheidung zwischen Innen- und Außenpolitik verschwimmt allerdings im Zuge von Globalisierungsprozessen, deren bestimmende Merkmale Vergesellschaftung und Entgrenzung sind. Vergesellschaftung bezieht sich auf den Bedeutungszuwachs, den nicht-staatliche Akteure in der internationalen Politik erfahren haben. Entgrenzung bezeichnet eine Konsequenz der Zunahme grenzüberschreitender Transaktionen, die vor allem von gesellschaftlichen Akteuren vorgenommen werden. Nicht mehr nur Staaten betreiben Außenpolitik, auch Unternehmen (Global Players) und zivilgesellschaftliche Organisationen (NGOs) verfügen über eine Vielzahl transnationaler Einflussmöglichkeiten. Die daraus resultierende Erhöhung und Verdichtung grenzüberschreitender Transaktionen – eine einfache Definition von Globalisierung – dehnt den vergleichsweise gering verregelten internationalen Raum aus in den bisher vergleichsweise hoch verregelten Nationalstaat. Gleichzeitig werden Elemente nationalstaatlicher Regelungen in den internationalen Raum ausgeweitet. Einerseits werden die Effekte internationalen Handelns leichter über Grenzen hinweg transportiert, andererseits bedingt der zunehmende grenzüberschreitende Austausch ein Mindestmaß an stabilen und verlässlichen Regelungen, die Transaktionen überhaupt erst möglich machen.
Dieser Wandel hat tiefgreifende Konsequenzen für die Außen- und Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert. Dramatisch sichtbar werden diese beispielsweise im Phänomen des internationalen Terrorismus, des „terrorism with global reach“. Nicht zuletzt die auf freizügigem gesellschaftlichem Austausch basierende globale Ökonomie erleichtert es terroristischen Gruppen, weltweit mörderische Anschläge vorzunehmen. So lässt sich heute eine Flugausbildung in den USA leicht mit einer militärischen Grundausbildung in Afghanistan verbinden, die beide von einem Stützpunkt in Europa aus koordiniert werden. Gleichzeitig verschärft das Zusammenrücken der Welt zum sprichwörtlichen Dorf die Sichtbarkeit der Unterschiede zwischen Arm und Reich, verschiedenen Religionen, Ethnien usw. Damit sind konflikthafte Auseinandersetzungen über verschiedenste Konfliktgegenstände vorprogrammiert. Diese müssen nicht per se gewaltsam ausgetragen werden. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Austrags nimmt allerdings zu.
Krisenprävention und Konfliktbearbeitung als strategische Priorität
Wenn es stimmt, dass die Grenze zwischen Innen und Außen verschwimmt, gleichzeitig die Intensität und Reichweite der potenziellen Bedrohungen wächst, dann ist präventives Engagement mehr denn je gefordert. Globalisierungsprozesse, begriffen als Entgrenzung und Vergesellschaftung, machen eine internationale Struktur- und Ordnungspolitik notwendig. Ein wichtiges Element dieser internationalen Struktur- und Ordnungspolitik besteht in einer Kultur der (Krisen-) Prävention. Das ist (innen-) politisch nicht leicht zu kommunizieren, denn eine verhinderte Krise macht in der Regel keine Schlagzeilen. Die internationale Berichterstattung konzentriert sich häufig auf aktuelle Krisengebiete: Kriege, Bürgerkriege, Naturkatastrophen prägen das Bild der Öffentlichkeit über die Ereignisse in der Welt. Ist ein Krieg beendet oder eine Krise beseitigt, weil z.B. graugewandete Diplomaten in Sitzungssälen eine Lösung im Verhandlungswege erreichen konnten, schwindet das Interesse der Medien und daraus folgend auch das Interesse der Öffentlichkeit daran schlagartig. Dabei beginnt die Notwendigkeit zu internationaler Hilfeleistung oft erst dann im Anschluss an eine Konfliktregelung, etwa um das Wiederaufflammen eines Konfliktes zu verhindern und beim Wiederaufbau einer Region zu helfen. Neben die Krisenprävention tritt daher die dauerhafte und verlässliche Konfliktbearbeitung als zusätzliche strategische Priorität.
Krisenprävention kann begriffen werden als kurz- bis langfristiges Engagement, das die Entstehung, den Ausbruch und die Verbreitung von gewaltförmig ausgetragenen Konflikten verhindern will. Seit der Regierungsübernahme der rot-grünen Koalition 1998 sind Krisenprävention und Konfliktbearbeitung zu einem zentralen Element, wenn nicht gar zu einem Markenzeichen deutscher Außen- und Sicherheitspolitik geworden. Vorrangiges Ziel dieser Politik ist nicht Konfliktverhinderung an sich, denn Konflikte sind unvermeidbar und können durchaus produktiv sein, indem sie den dynamischen Wandel vorantreiben. Ziel ist es vielmehr, darauf hinzuwirken, dass Konflikte nicht gewaltsam, sondern gewaltfrei ausgetragen werden. Daraus folgt bereits der Primat einer präventiven Krisenbearbeitung, um gewaltträchtige Eskalationsprozesse so weit wie möglich auszuschließen.
Die im Dezember 2003 verabschiedete Sicherheitsstrategie der Europäischen Union (ESS) greift diesen Politikansatz auf. Mit der ESS reagiert die EU auf die während des Irak-Konflikts deutlich wahrnehmbaren Unstimmigkeiten zwischen einigen Mitgliedstaaten und nimmt gleichzeitig die komplexen Herausforderungen globaler Politik im 21. Jahrhundert an. Die ESS definiert zum ersten Mal die gemeinsamen strategischen Interessen der EU in der Außen- und Sicherheitspolitik, thematisiert aber auch Umwelt-, Entwicklungs- und Wirtschaftspolitik. Selbstverständlich ist das nicht: Dass so unterschiedliche Politikfelder miteinander verbunden werden, um eine integrative Außenpolitik zu schaffen, ist in dieser Form zumindest auf europäischer Ebene neu. Hier finden sich die Ansätze einer internationalen Struktur- und Ordnungspolitik mit europäischem Akzent – dies im klaren Unterschied zur Nationalen Sicherheitsstrategie und der daraus abgeleiteten Außen- und Sicherheitspolitik der Bush-Administration in den USA.
Der Gedanke der Krisenprävention ist natürlich nicht neu. Die Gewalt aus den internationalen Beziehungen zu verbannen oder sie zumindest einzudämmen war das Gründungsmotiv der Vereinten Nationen (VN), ist Essenz der VN-Charta und einer ihrer Kernaufträge geblieben. Gewaltfreiheit war auch und gerade im Ost-West-Konflikt ein zentrales Ziel deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts stellt systematische Krisenprävention jedoch eine neue und dringliche Aufgabe staatlichen Handelns dar. Nach Beendigung des Ost-West-Konflikts ist die Welt insgesamt nicht sicherer geworden. Zwar herrscht in der OECD-Welt ein stabiler zwischenstaatlicher Frieden und diese Errungenschaft sollte keineswegs geringgeschätzt werden. Dass Kriege zwischen OECD-Staaten kaum noch vorstellbar und gerade in Europa vielfach Konzepte gemeinsamer und geteilter Sicherheit institutionalisiert sind, ist angesichts der ausgesprochen gewalttätigen Vergangenheit des Kontinents eine bemerkenswerte Entwicklung. Die EU hat mit der Realisierung der Idee der freiwillig eingeschränkten, geteilten Souveränität zur Entstehung dieser stabilen Friedenszone wesentlich beigetragen.
Außerhalb der Friedenszone werden jedoch nach wie vor Kriege geführt, in die vielfach auch OECD-Staaten verwickelt sind. Die Welt außerhalb der OECD wird vielleicht stärker denn je geprägt durch gewaltförmig ausgetragene Konflikte. Gerade in diesen Konflikten verschwimmen die Grenzen zwischen einerseits Innen und Außen und andererseits staatlichen und gesellschaftlichen Akteuren zusehends. Es entstehen ganze Konfliktregionen wie etwa um die Großen Seen im zentralen Afrika oder nördlich und südlich des Kaukasus, in denen die bestehenden Grenzen zwar durchaus Bedeutung haben, gewaltförmig ausgetragene Auseinandersetzungen diese Grenzen aber regelmäßig überschreiten. Dies hängt auch mit dem Auftreten gesellschaftlicher Gruppen wie beispielsweise paramilitärischer Milizen oder international agierender Terrornetzwerke zusammen, die sich nicht entlang staatlicher Grenzen, sondern entlang anderer Kriterien wie Religion, Ethnie oder Sprache organisieren.
Die Bedrohungen von Frieden und Sicherheit tragen daher heute ein anderes Gesicht als noch vor wenigen Jahren. Die Zahl zwischenstaatlicher Konflikte hat abgenommen und ‚klassische‘ friedenserhaltende Maßnahmen zwischen einzelnen Staaten – entwickelt von den Vereinten Nationen unter den Bedingungen des Ost-West-Konflikts – sind heute die Ausnahme. Stattdessen dominieren komplexe innerstaatliche Konflikte mit Gefahren für einzelne Menschen und Bevölkerungsgruppen, aber auch der Gefahr eines „spill over“, d.h. der Gefahr einer Beeinträchtigung der Sicherheit von Nachbarstaaten oder der ganzen Region. Die Ursachen innerstaatlicher Konflikte sind diffus. Wir haben es in der Regel mit komplexen Ursachenbündeln zu tun, in denen Machtkämpfe und ökonomische Verteilungskämpfe oftmals von ethnischen und religiösen Antagonismen überlagert bzw. instrumentalisiert werden. Dabei sind neue Konfliktursachen virulenter geworden, etwa das durch Umweltdegradation und Ressourcenkonflikte (Beispiel Wasserknappheit) wachsende Konfliktpotential. Es mehren sich die Fälle, in denen „fragile“ Staaten, also Länder mit nur schwach ausgeprägten gesellschaftlichen Strukturen, quasi zur „Beute“ marodierender Militärs oder Privatarmeen werden. Diese „Privatisierung“ der Bürgerkriegsführung in vielen Ländern befördert die Zunahme von sogenannten scheiternden Staaten (failing states). Zudem wird mit der Zunahme der Bürgerkriegsakteure die Suche nach Anknüpfungspunkten für friedliche Konfliktlösungen empfindlich erschwert. In vielen Weltregionen werden immer noch zu viele Waffen angehäuft. Gerade die jüngsten Bürgerkriege zeigen, welche verheerenden Folgen der von mafiösen Strukturen dominierte zügellose internationale Waffenmarkt zeitigt. Regionale Abrüstung, Rüstungskontrolle und Vertrauensbildung bleiben daher auch auf lange Sicht integrale Bestandteile einer Konfliktpräventionspolitik.
Doch nicht nur innerstaatliche Auseinandersetzungen unterliegen diesen Konfliktdynamiken. Zwar bleibt die unmittelbare Drohung mit militärischer Gewalt weiterhin zentraler Konfliktbeschleuniger. Hinzu kommen Armut, die in Verbindung mit mangelnder Gleichberechtigung der gesellschaftlichen Gruppen in einem Land (diese findet ihren Ausdruck zumeist in einem ungleichberechtigten Zugang zu politischer Macht) zu einer explosiven Mischung führt, wirtschaftlicher Niedergang, gezieltes Schüren schwelender Unzufriedenheit sowie demagogischer Missbrauch ethnischer, religiöser oder nationalistischer Ideen. Daneben treten im Zeitalter der Globalisierung zunehmend andere Bedrohungspotentiale: Umweltzerstörung und Unterentwicklung, Bevölkerungswachstum und Ressourcenknappheit, Menschenrechtsverletzungen, Terrorismus, Drogen, organisierte Kriminalität und die Proliferation von Waffen, besonders Kleinwaffen, sind heute Sicherheitsrisiken, die in offene Gewaltanwendung münden können. In diesem Kontext kann es für die friedliche Entwicklung einer ganzen Region sinnvoller sein, einen Dialog mit einem schwierigen Partner wie z.B. Nordkorea zu führen, als ein nukleares Abschirmprogramm zu installieren.
Deutlich wird die größere Rolle gesellschaftlicher Akteure in gewaltförmig ausgetragenen Konflikten. So gehen die wichtigsten Risiken und Gefahren für die EU heute nicht mehr von feindseligen Staaten aus. Dies wird bei den Bedrohungen deutlich, die in der ESS genannt werden: 1. Internationaler Terrorismus, 2. Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, 3. Regionale Konflikte, 4. Scheiternde Staaten, 5. Organisierte Kriminalität. Die Auswahl zeigt, dass sich Bedrohungen wegverlagert haben von Staaten hin zu gesellschaftlichen Akteuren. An ihnen geht das klassische Instrumentarium zur Abwehr von Bedrohungen, der Aufbau militärischer Abschreckungskapazitäten, glatt vorbei. Jede Außen- und Sicherheitspolitik muss darauf reagieren. Staaten lassen sich vielleicht militärisch abschrecken, gegen Selbstmordattentäter und organisierte Kriminalität helfen Raketenabwehrsysteme nichts. Hier müssen andere Instrumente greifen, die den politischen, sozialen und ökonomischen Ursachen der neuen Bedrohungen gerecht zu werden. Dies kann nur auf der Basis eines multilateralen, mehrebenenorientierten Ansatzes geschehen, der nicht nur Staaten, sondern auch Gesellschaften berücksichtigt. Eine Global Governance-Architektur könnte einen brauchbaren Rahmen für einen solchen Ansatz abgeben.
Bedingungen einer institutionalisierten Politik der Krisenprävention
Die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik zielt angesichts dieses Konfliktpanoramas darauf, die internationalen Beziehungen mit eigenen Impulsen und Vorschlägen weiter zu zivilisieren, sie zu verrechtlichen und insgesamt einen ökonomischen, ökologischen und sozial gerechten Interessenausgleich der Weltregionen zu fördern. Hier geht es um eine Neubestimmung des Verhältnisses militärischer und ziviler Konfliktbearbeitung. Die politische Entscheidung, der zivilen Krisenprävention zukünftig bei der Gestaltung auswärtiger Beziehungen ein stärkeres Gewicht einzuräumen, beruht auf der Einsicht, dass der Rückgriff auf militärische Mittel komplexen Konfliktlagen nicht mehr gerecht wird. Die wirksame Verhütung gewaltförmig ausgetragener Konflikte ist eine vorrangig politische und nicht militärische Aufgabe. Konflikten wirksam vorzubeugen, sie zivilisiert zu bewältigen, heißt vor allem, ihre Ursachen vorausschauend zu bekämpfen. Krisenprävention erfordert daher eine auf die jeweilige Situation und das jeweilige Umfeld zugeschnittene politische Gesamtstrategie, die das außen- und sicherheitspolitische Instrumentarium in einem koordinierten Handlungsrahmen eng mit dem entwicklungs-, wirtschafts-, umwelt- und rechtspolitischen Instrumentarium verzahnt. Nötig ist daher eine integrative Außenpolitik. Für die Bewältigung innergesellschaftlicher Konflikte müssen beispielsweise rechtsstaatliche Mindeststandards vorhanden sein, die nicht nur mit Mitteln der Außenpolitik (z.B. im Rahmen eines Menschenrechtsdialogs über rechtliche Standards oder die Stärkung der Pressefreiheit) gefördert werden können, sondern mit dem gesamten verfügbaren Instrumentarium aller Regierungsakteure.
Dieser erweiterte Sicherheitsbegriff ist zur Leitlinie der Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesregierung geworden. Er hat drei zentrale Dimensionen:
- Umfassende Sicherheit: Wegen der Vielfältigkeit der Konfliktursachen erfordert eine moderne Außen- und Sicherheitspolitik ein umfassendes Spektrum von Instrumenten, das sich weder allein noch vorrangig auf militärische Mittel stützt.
- Gemeinsame Sicherheit: Kein Staat kann für sich allein Frieden, Sicherheit und Wohlfahrt gewährleisten. Integration und Kooperation mit Partnern und Verbündeten sowie das Zusammenwirken in internationalen Organisationen sind mehr denn je unerlässlich für eine umfassende Sicherheitsvorsorge.
- Präventive Sicherheit: Gewalt bringt Leid und Opfer mit sich. Aber Gewaltkonflikte können auch Auswirkungen auf Unbeteiligte haben (z.B. durch Flüchtlingsströme oder ökonomische und ökologische Schäden, die sich nicht an Grenzen halten), und sie können sich ausweiten und Dritte hineinziehen. Oberstes Ziel von Außen- und Sicherheitspolitik ist es deshalb, Gewalt zu verhindern. Gelingt dies aber nicht, muss dafür gesorgt werden, dass Gewalt nach ihrem Ausbruch so rasch wie möglich beendet wird. „Post-conflict peace-building“ ist dann die aktuelle Methode der Konfliktbearbeitung. Außen- und Sicherheitspolitik muss deshalb über das gesamte Spektrum von Krisenprävention, Krisenbewältigung und Krisennachsorge handlungsfähig sein.
Damit sind Ansatz und Rahmenbedingungen einer institutionalisierten Politik der Krisenprävention umrissen. Wie sollte eine Politik der Krisenprävention aber konkret angelegt sein, um die gewünschten Effekte erzielen zu können? Dazu einige thesenartige Anmerkungen:
– Gewaltprävention ist möglich: Krieg und Gewalt gehören seit ihren Anfängen zur menschlichen Geschichte. Sie sind jedoch kein unabänderliches Naturgesetz und sie lassen sich auch nicht allein durch Androhung von Gegengewalt verhindern. Im Gegenteil: ein Frieden, der sich wie zur Zeit der Ost-West-Konfrontation auch auf gegenseitige Abschreckung stützen musste, bleibt ein prekärer Frieden mit verheerenden Folgen, falls Abschreckung versagt. Ein stabiler Frieden hingegen kommt ohne Androhung von Gewalt aus. Dass er möglich ist, zeigt die Geschichte: Aus der deutsch-französischen Erzfeindschaft ist eine „Erzfreundschaft“ geworden. Was für diese beiden Ländern gilt, gilt für die Europäische Union insgesamt ebenso wie für das transatlantische Verhältnis.
– Um Gewalt zu verhindern, ist die Schaffung einer weltweiten „Kultur der Prävention“ notwendig. Krisenprävention als ein Kernziel deutscher Außen- und Sicherheitspolitik steht vor zwei Herausforderungen:
- Die in der westlichen Hemisphäre entstandene Friedensgemeinschaft zu erhalten und sukzessive auszudehnen;
- Darüber hinaus weltweit zur Schaffung einer „Kultur der Prävention“ beizutragen. Dabei kann die EU-Vorbild, aber nicht Vorlage sein, die andere nur zu kopieren brauchen. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit – einschließlich demokratischer Kontrolle des Militärs -, wirtschaftliche Entwicklung und sozialer Ausgleich sind keine exklusiv „europäischen“ oder „westlichen“ Normen krisenpräventiven Verhaltens, aber wie sie praktiziert und institutionalisiert werden, lässt sich nicht über einen globalen Leisten schlagen. Eine „Kultur der Prävention“ kann auch nicht von außen aufgezwungen werden. Frieden muss von den Konfliktparteien selbst gewollt sein, wenn er dauerhaft sein soll. Die europäische Geschichte zeigt, dass dies ein sehr langwieriger Prozess sein kann.
– Krisenprävention muss langfristig, kohärent und zivil sein: Krisenprävention ist umso wirksamer, je mehr es gelingt, die erwähnten strukturellen Ursachen von Gewalt abzubauen, also Armut und krasse Ungleichverteilung, Unterdrückung und Intoleranz, ökonomische Perspektivlosigkeit und ökologischer Raubbau. Eine Politik der strukturellen Krisenprävention braucht einen langen Atem. Strukturelle Krisenprävention ist dabei umso wirksamer, je kohärenter sie ist. Kohärenz heißt in diesem Kontext Ausrichtung der gesamten Außen- und Sicherheitspolitik am Ziel der Gewaltverhinderung. Dies gilt von der EU-Erweiterung über Entwicklungs- und Handelspolitik bis hin zu internationaler Finanz- und Umweltpolitik. In der Tat: Krisenprävention muss sich vor allem auf diesen politischen „Großfeldern“ bewähren. Das zeigt: Krisenprävention ist eine Herausforderung, die vorrangig mit zivilen Mitteln zu bewältigen ist.
- Krisenprävention und Konfliktbearbeitung gehören zusammen: Durch wirksame Reaktion der Staatengemeinschaft auf akut drohende Gewalt soll ihr Ausbruch verhindert werden. Wenn dies nicht gelingt, ist die Beendigung von Gewalt der erste notwendige Schritt zur Prävention, die ein Wiederaufflammen der Gewalt verhindern soll. Deshalb können militärische Mittel zur Krisenprävention und Konfliktbearbeitung zwar notwendig sein, ihr tatsächlicher Einsatz darf aber immer nur eine „ultima ratio“-Option sein, die zivile Bemühungen nicht ersetzen, sondern nur ergänzen kann. Ein Wort noch zur Rolle der Streitkräfte: natürlich geht es nicht nur um ihren Einsatz in Krisengebieten, sondern auch um ihren Beitrag zur Gewährleistung von Sicherheit und Stabilität in Friedenszeiten, so wie umgekehrt Abrüstung und Rüstungskontrolle zu den unverzichtbaren Elementen einer wirksamen Prävention gehören.
Institutionelle Ausgestaltung
Angesichts der Größe der Herausforderung ist klar, dass eine solche Politik im globalen Maßstab nicht von einzelnen Staaten geleistet werden kann. Internationale Kooperation ist daher unabdingbar. Dabei kommt es vor allem darauf an, die Eigenverantwortung der Regionen außerhalb der OECD-Welt zu stärken. Von außen kommende „Lösungen“ für Krisen werden in der Regel nur widerwillig akzeptiert und umgesetzt. Daher ist der Ansatz der Eigenverantwortung bzw. von „ownership“ zentraler Bestandteil der EU-Konzeption von Außen- und Sicherheitspolitik. Ein handlungsfähiges Instrumentarium zur Krisenprävention kann nur gemeinsam mit verlässlichen Partnern in der internationalen Staatengemeinschaft entwickelt werden. In diesem Zusammenhang sind verschiedene internationale Organisationen auf globaler und regionaler Ebene aktiv:
- Dies gilt in erster Linie für den Rahmen der Vereinten Nationen als der wichtigsten Ebene zur Lösung globaler Fragen, deren Aufgabe die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit ist. Die VN haben ihr seit 1945 praktiziertes klassisches Instrumentarium zur friedlichen Konfliktbeilegung nach Kap. VI der VN-Charta in der „Agenda for Peace“ von 1992 erweitert, vor allem durch den präventiven Einsatz von Friedenstruppen, die Schaffung von „stand by forces“ der VN und die Stärkung der Rolle der Regionalorganisationen in diesem Bereich. Deutschland beteiligt sich an „stand-by-arrangements“ der VN und unterstützt VN-Missionen mit zivilem Personal (z.B. Entsendung von Polizisten nach Bosnien und Kosovo) und militärischen Kapazitäten (aktuell beispielsweise in Südosteuropa und Afghanistan, aber auch durch ein kleines Kontingent von militärischen Beobachtern in der Grenzregion zwischen Äthiopien und Eritrea). Vor allem nach den bitteren Lektionen in Somalia und Ruanda stellte sich die Frage nach weiteren Reformen des Systems der Friedenserhaltenden Maßnahmen der VN. Als Reaktion darauf hat die Organisation mit dem Brahimi-Bericht im Jahr 2000 eine tiefgreifende Studie zum Reformbedarf der VN-Friedensmissionen vorgelegt. Nach wie vor aktuell sind die Forderungen in diesem Bericht. Sie zielen nicht allein auf durchsetzungsfähige Friedentruppen, sondern verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz zur Verbesserung der VN-Kapazitäten in den Bereichen early warning, early action und post-conflict peace-building. Eine umfassende Reform ist allerdings nicht zum sprichwörtlichen Nulltarif zu bekommen. Die Bundesregierung unterstützt die Reformpolitik der VN mit konkreten personellen und konzeptionellen Beiträgen. In diesem Zusammenhang ist auch die jüngst erneut bekräftigte Bereitschaft der Bundesrepublik zu sehen, mehr internationale Verantwortung im Rahmen einer ständigen Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der VN zu übernehmen.
– Die OSZE hat seit 1992 ihr Instrumentarium der zivilen Krisenprävention konsequent ausgebaut. Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Entsendung von OSZE-Langzeitmissionen, die – wie der Name sagt – über längere Zeiträume die Entwicklung in den Zielregionen (beispielsweise im Südkaukasus und in Südosteuropa) beobachten sollen. In Reaktion auf die Ereignisse im Kosovo im Jahr 1999 wurden zivile Krisenreaktionskräfte (REACT) geschaffen und die operativen Fähigkeiten des OSZE-Sekretariats gestärkt. Dieses Ziel wurde auch in der 1999 in Istanbul verabschiedeten Sicherheitscharta verankert. Seitdem ist es gelungen, eine Personalreserve von Experten aufzubauen, die nach einheitlichen Kriterien von den Teilnehmerstaaten rekrutiert und ausgebildet werden und die kurzfristig für Einsätze zur Verfügung stehen. Hierdurch ist der Aufbau relativ großer neuer Missionen innerhalb relativ kurzer Zeit möglich (ca. 30 Tage).
– Die EU ist ein ganz besonderer Fall: Zum einen ist sie selbst ein gelungenes Beispiel für dauerhafte Krisenprävention, weil ihre Mitgliedstaaten Konflikte untereinander ausschließlich gewaltfrei austragen, zum anderen hat sie angesichts ihres wirtschaftlichen Potentials, ihrer politischen Bedeutung und ihres friedenspolitisches Modellcharakters große Möglichkeiten, auch nach außen krisenpräventiv zu wirken. So ist z.B. die Erweiterung der EU auch und nicht zuletzt ein Projekt der Friedenssicherung. Mit dem Beitritt von 10 Staaten zum 1. Mai 2004 hat die EU die Zone stabilen Friedens erheblich ausgeweitet. Die EU setzt aber nicht allein auf dieses Projekt. Sukzessive ist in den letzten Jahren die außen- und sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit verbessert worden. Die ESS ist der bisher weitgehendste Ausdruck dieser Entwicklung. Dabei legt die EU großen Wert auf die Entwicklung von zivilen Instrumenten. So hat der Europäische Rat in Helsinki 1999 zur Stärkung der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) einen Aktionsplan zur zivilen Krisenprävention und Konfliktbearbeitung beschlossen. Dabei geht es um den Auf- und Ausbau von Personal und Fähigkeiten, die in internationalen Friedensmissionen, vor allem von VN und OSZE, zum Einsatz kommen können. Schwerpunkte sind Polizei, rechtsstaatliche Strukturen, Zivilverwaltung und Katastrophenschutz. Auch im Rahmen der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit hat die EU-Krisenprävention zu einem Hauptkriterium gemacht. Die EU hat hier in der Tat einen unschätzbaren Vorteil: Dank des differenzierten Potentials ihrer Mitgliedstaaten verfügt sie über ein außerordentlich breites Spektrum von wirksamen Instrumenten zur Krisenprävention und Konfliktbearbeitung.
- Die NATO bleibt nicht nur unverzichtbar als transatlantische Klammer, Konsultationsrahmen und Rückversicherung für den „worst case“ der kollektiven Verteidigung. Die Erfahrungen seit dem Kosovo-Einsatz 1999 haben deutlich gemacht, dass die NATO sich im Verbund mit anderen Kräften und auf der Basis von Mandaten der internationalen Staatengemeinschaft im Extremfall an militärischen Aktionen zur Beendigung von Völkermord und humanitären Katastrophen beteiligen kann. Die NATO selbst und ihre Kooperationsstrukturen wie „Partnership for Peace“ und der NATO-Russland–Rat sind Meilensteine in der Überwindung national orientierten Sicherheitsdenkens. Die im strategischen Konzept der NATO enthaltene Orientierung auf Krisenprävention erhält auch durch die krisenpräventive Politik der Bundesregierung Substanz.
– Auch für die G8 sind Fragen der Krisenprävention mittlerweile zentrales Politikziel. Ausgehend vom Gipfeltreffen in Köln 1999 hat sich die G8 für eine konzentrierte, umfassende und kohärente Politik der Prävention gewaltsam ausgetragener Konflikte eingesetzt. Ein Kernelement ist die nachhaltige Unterstützung für den Aufbau demokratischer Institutionen in Konfliktregionen. In den letzten Jahren sind konkrete Initiativen wie z.B. die Bekämpfung unkontrollierter und illegaler Weitergabe von Kleinwaffen und des für Kriegsfinanzierung betriebenen illegalen Diamantenhandels vereinbart worden. Das Potential der G8 im Rahmen einer international betriebenen Struktur- und Ordnungspolitik verdeutlicht etwa die Zusammenarbeit mit reformwilligen afrikanischen Staaten bei der Entwicklung einer gemeinsamen Partnerschaft (New Partnership for Africa’s Development, NePAD).
Auf nationaler Ebene äußert sich das deutsche Engagement für Krisenprävention und Konfliktbearbeitung u.a. in folgenden Aktivitäten:
- Am 7. April 2004 hat die Bunderegierung ein Gesamtkonzept zur Krisenprävention und Konfliktbeilegung vorgelegt. Kernpunkte des Konzeptes sind die Entwicklung und Anwendung wirksamer Strategien und Instrumente der Krisenprävention, friedlichen Konfliktbeilegung und Friedenskonsolidierung. Daran beteiligt sind – unter Federführung des Auswärtigen Amtes – die Ressorts, die nach außen gerichtete Politik betreiben, in erster Linie neben dem AA das Bundesverteidigungsministerium und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das Konzept legt eine politische Gesamtstrategie der Bundesregierung für den Bereich der Krisenprävention und Konfliktbearbeitung fest. In diese Gesamtstrategie werden nichtstaatliche Akteure (NGOs, Wirtschaft, Kirchen usw.) systematisch einbezogen. Damit ist Krisenprävention zu einem institutionellen Bestandteil deutscher Politik geworden.
- Das Auswärtige Amt verfügt über Mittel für internationale Maßnahmen auf den Gebieten Krisenprävention, Friedenserhaltung und Konfliktbewältigung, die von der rot-grünen Bundesregierung deutlich aufgestockt worden sind. Im Haushalt 2004 sind sie in einer Höhe von ca. € 13,9 Mio. veranschlagt. Mit diesen Mitteln können relativ kurzfristig internationale krisenpräventive Projekte unterstützt werden, die in der Vergangenheit keine finanzielle Hilfe erfahren haben. Auch in der Ausbildung ist Krisenprävention inzwischen verankert. So hat das Auswärtige Amt 1999 in seiner Ausbildungsstätte in Bonn ein Ausbildungszentrum für ziviles Friedenspersonal geschaffen. Am 1. Juli 2002 hat das ZIF (Zentrum für Internationale Friedenseinsätze) das bestehende Trainingsprogramm des Auswärtigen Amts für ziviles Friedenspersonal übernommen. Das ZIF ist in folgenden Aufgabenbereichen tätig:
– Training von zivilen Fach- und Führungskräften für internationale Friedens- und Beobachtungseinsätze, die von den Vereinten Nationen (UNO), der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), der Europäischen Union (EU) oder anderen internationalen Einrichtungen beschlossen oder durchgeführt werden. Die Vorbereitungskurse dienen dem Ziel, zügig eine geeignete Personalreserve von Fachleuten zu schaffen, die im Bedarfsfall kurzfristig für die unterschiedlichen Friedensmissionen von VN, OSZE und anderen Regionalorganisationen mobilisiert werden können. Zum Programm gehören neben der Vermittlung grundlegender Fähigkeiten wie Erster Hilfe, Logistik, Funkverkehr und Orientierung im Gelände auch der Schutz vor Landminen und die psychologische Vorbereitung auf den Einsatz. Mittelpunkt der theoretischen Ausbildung sind die Grundlagen des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte sowie Verhandlungstechnik und Konfliktbewältigung.
– Aufbau und Pflege einer Reserve von qualifizierten zivilen Fach- und Führungskräften (Personalreserve) zur schnellen und gezielten Bereitstellung für solche Einsätze; Rekrutierung; Betreuung und Nachbetreuung des eingesetzten Personals.
– Unabhängige wissenschaftliche Analyse, Konzeption, Beratung, Information und Netzwerkpflege.
– Das Bundesministerium der Verteidigung hat einen umfassenden Prozess der Umstrukturierung und Neuausrichtung der Bundeswehr eingeleitet. Dieser soll dazu beitragen, dass künftig gemeinsam mit den deutschen Partnern in EU und NATO ein wirksamer Beitrag auch zur militärischen Krisenprävention und im Extremfall der Krisenbewältigung geleistet werden kann, wenn zivile Mittel versagen. Das Engagement der Bundeswehr bei der zivil-militärischen Zusammenarbeit (CIMIC) etwa im Kosovo und in Afghanistan zeigt, dass Krisenprävention und Konfliktbearbeitung in der post-bipolaren Welt zu einer Aufgabe werden, die nur durch gemeinsames Handeln verschiedener Akteure, die aber einem kohärenten Konzept folgen, gemeistert werden kann.
- Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat in enger Abstimmung mit den beteiligten nichtstaatlichen Trägern und dem Auswärtigen Amt den Zivilen Friedensdienst (ZFD) als ein neues Element der Krisenprävention und Konfliktbearbeitung im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit gegründet.
Die Verankerung der von den VN geforderten „Kultur der Prävention“ in der internationalen Politik ist ein langfristiges Ziel. Alle Akteure, national wie international, sind auf allen Ebenen dazu aufgerufen, sich daran zu beteiligen. Dabei ist große Umsicht erforderlich: Vor allem bei innerstaatlichen Konflikten muss der mögliche Vorwurf der Einmischung in die innere Angelegenheit von Staaten, also der Anschein der Verletzung der staatlichen Souveränität, vermieden werden. Dies ist bei der Unterstützung von Maßnahmen internationaler Organisationen im krisenpräventiven Bereich, vor allem der VN, einfacher als bei rein nationalen Maßnahmen. Daraus folgt die Notwendigkeit einer weiteren, breiter angelegten Internationalisierung von Lösungsansätzen. Grundlage dafür kann eine systematische Zusammenarbeit zwischen lokalen und nationalen, zwischen regionalen und globalen Akteuren und Organisationen sein. Eine solche Global Governance-Architektur würde die eingangs geforderte „Kultur der Prävention“ mit zivilen Mitteln nachhaltig befördern.
Grenzen des Engagements
Allerdings gilt es auch, zu reflektieren, wo die Grenzen des internationalen Engagements liegen. Krisenprävention setzt den Willen und die Fähigkeit zum frühzeitigen und dauerhaften grenzüberschreitenden Engagement voraus. Das Problem der Durchhaltefähigkeit, der Überforderung der Kapazitäten der interventionswilligen und ‑fähigen Staaten tritt aber immer deutlicher zutage. Im Irak steht die Durchhaltefähigkeit der US-Armee in Frage, und dies nach einem vergleichsweise einfachen Feldzug. Dies hängt, wie gesehen, mit den gewandelten außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen zusammen, auf die Staaten oft keine zureichende Antwort haben. Die Asymmetrisierung des Konfliktaustrags, also die zunehmende Zahl von Konflikten, in denen nicht-staatliche Akteure eine Konfliktpartei sind, ist hier zu nennen. Eine Politik, die im Weltmaßstab zur gewaltfreien Prävention von aus solchen Problemlagen entstehenden Krisen durchgeführt werden soll, ist allerdings teuer. Möglicherweise überfordert sie sogar die zur Verfügung stehenden europäischen Kräfte. Daher ist die partnerschaftliche Kooperation mit den USA im unmittelbaren europäischen Eigeninteresse. Der Balkan, Osteuropa, der Nahe Osten und der Mittelmeerraum – das sind die Nachbarregionen, in denen die EU sich vorrangig engagieren muss, ohne dabei Lateinamerika, Afrika und Asien aus dem Blick zu verlieren. Vor diesem Hintergrund ist die Heranführung einer gemäß den Gemeinschaftsstandards reformierten Türkei an die EU auch eine strategische Aufgabe mit dem Ziel, langfristig zur Stabilisierung und Demokratisierung des Nahen Ostens beizutragen.