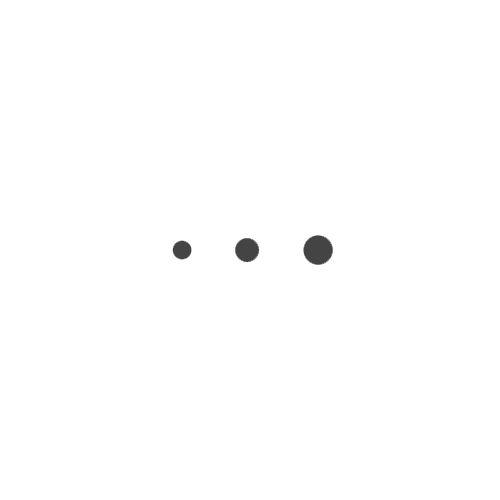(unveröffentlichtes Arbeitspapier, 29. Juni 2020)
Der Oberbegriff zu allen Friedens-, Abrüstungs- und Verteidigungspolitiken ist der der Sicherheitspolitik. Diese beruht immer auf einer ex- oder impliziten Bedrohungsanalyse oder auf der Formulierung eigener offensiver Ambitionen. Dass sie „nationalen Interessen“ zu folgen habe, ist ein soziales Konstrukt, keine dem Staate immanente Wesenhaftigkeit. Auch ist nicht zwingend, dass Sicherheitspolitik (vorwiegend) militärisch organisiert sein muss. Eine falsche Bedrohungsanalyse ist so gefährlich wie eine richtige Bedrohung. Sie produziert Feindbilder und setzt Rüstungsspiralen in Gang.
Heute hat die traditionelle militärische Sicherheitspolitik wieder an Bedeutung zugelegt; nicht, weil sie unausweichlich ist, sondern weil die Alternativen in den letzten 20 Jahren wieder vernachlässigt wurden und weil törichte, aber wichtige Akteure auf militärische Macht-Optionen setzen.
Deshalb sind die traditionellen Handlungsfelder der (atomaren) Rüstungskontrolle, Abrüstung, militärischen Integration etc. nach wie vor/wieder relevant, zumindest um Rückfälle oder plötzliche Zuspitzungen zu verhindern. Eine Beschränkung darauf aber kann im besten Falle einen „negativen Frieden“ (Abwesenheit von Krieg) bringen, jedoch keinen „positiven Frieden“ im Sinne der Bewältigung kriseninduzierender sozialer und ökologischer Probleme. (Kampagnen gegen Rüstungsexporte sind übrigens ebenso sympathisch wie hilflos, weil sie nur abgeleitete Phänomene betreffen.)
Der umgekehrte Ansatz scheint aussichtsreicher: nicht die Verfolgung des sog. „nationalen Interesses“, sondern die aktive Bearbeitung regionaler und globaler Probleme kann Konfliktlösungen bringen, die Entmilitarisierungsprozesse begünstigen. „Krisenprävention, zivile Konfliktbearbeitung und Post-conflict-peacebuilding“ lauten die Schlagworte.
Regionale Krisenprävention versucht durch „Early warning“ und „Early action“ die Eskalation von innergesellschaftlichen oder internationalen Konflikten zu Krisen zu prognostizieren und zu verhindern. Es kommt darauf an, diese unter der Gewaltschwelle zu halten („Gewaltprävention“). Bei eskalierten Konflikten gilt das „DDR“-Prinzip: Disarmament, Demobilisation, Reconciliation.
Die (rot-grüne) Bundesregierung hat in Kooperation mit Friedensforschungsinstituten von 1998 bis 2005 Instrumente für eine solche Politik entwickelt. Zudem hat sie Krisenprävention als vorrangigen Ansatz in der Europäischen Sicherheitsstrategie (ESS) der EU verankert. Obwohl die Instrumente wie das „Zentrum für Internationale Friedensmissionen (ZIF)“ und die Förderung der „Zivilen Friedensdienste“ international als Leuchtturmprojekte gelten, ist ihre Bedeutung für die deutsche Außenpolitik seitdem wieder geschrumpft. Dabei darf Krisenprävention nicht ein Instrument neben anderen sein, sondern muss die Grundphilosophie der deutschen Außenpolitik bilden.
Globale Krisenprävention und Konfliktbearbeitung stützt sich zum einen auf die Institutionen der Vereinten Nationen. Sie tut alles, um Multilateralismus und die Geltung des Völkerrechts gegen einzelstaatliche Machtambitionen und militärgestützte Machtprojektionen durchzusetzen. Dabei stößt sie seit langem nicht nur an die (Groß-) Machtinteressen von Unilateralisten, sondern an immanente Konstruktionsfehler der UNO-Charta und des Völkerrechts, die sich zäh Reformen widersetzen.
Wichtiger wurde deshalb zunehmend der Ansatz der „Global governance“. Neben die staatlichen sind all die nicht-staatlichen Akteure getreten, deren transnationales Handeln Einfluss auf die Zuspitzung oder Deeskalation von Konflikten hat. Friedenspolitik identifiziert und stärkt aktiv die Akteure und Strukturen, die nicht Teil des Problems, sondern der Lösung sind.
Regionales Krisenmanagement und Global governance sind ebenso wenig Garanten für ewigen Frieden wie die militärische Abschreckung. Auch ihre Wirksamkeit muss auf Reichweite und Grenze abgeklopft werden. Jedoch – so die These – engagiertes (staatliches) Handeln auf dieser Ebene wird den militärpolitischen Diskurs wieder in den Hintergrund drängen.
Auch wenn nicht-militärische Sicherheitspolitik weniger kostenträchtig scheint als militärische – durch größeren Finanzeinsatz kann sie effizienter werden. Das betrifft nicht nur die spezifischen Titel im Bundeshaushalt von der Entwicklungspolitik bis zur auswärtigen Kulturpolitik, sondern auch die Beiträge für internationale Programme. Die deutsche Politik täte gut daran, diese Aufwendungen als sicherheitspolitische Leistungen auszuweisen und mit den Forderungen nach Erhöhung des Nato-Beitrags zu verrechnen.
Beispiel: Warum wird nicht folgender Deal gemacht? Wenn ein Staat auf die Abholzung seiner Wälder und die industrielle Nutzung der Rodungsflächen verzichtet, um weiterhin Sauerstoff für die gesamte Menschheit zu produzieren, wird ihm der Verzicht aus einem international gespeisten Fond finanziell vergolten. Eine Leistung für die Weltgemeinschaft statt privaten/nationalen Profits muss sich lohnen dürfen. Eine Investition in einen solchen Fond dürfte sicherheitspolitisch effizienter sein als manch ein Rüstungsprojekt.
Fazit:
Deutschland sollte nicht internationale Politik im nationalen Interesse betreiben, sondern deutsche Politik im globalen Interesse.
(Im Dezember 2016 versuchten Mitglieder des Willy-Brandt-Kreises zusammen mit Partnern in Deutschland und den USA dort im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen eine Initiative zur Wiederbelebung der Entspannungspolitik zwischen dem Westen und Russland zu starten. Hier der Aufruf in der Zeitung „The Nation“: Détente now! Neue Entspannungspolitik jetzt!)