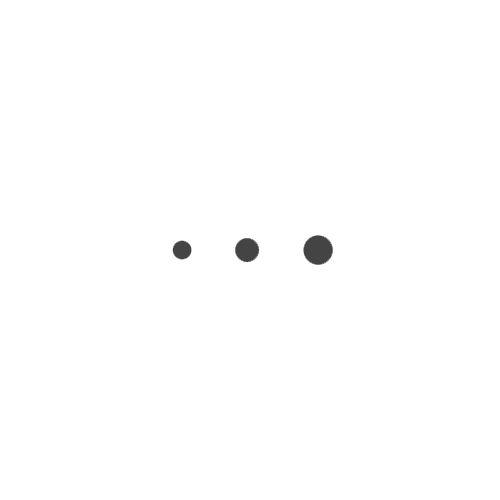(Policy Paper für die Grünen vom 24. Februar 1999, bisher unveröffentlicht)
Die Deutschen unten, die Russen draußen und die Amerikaner drinnen zu halten – das war die dreifache Gründungsaufgabe der NATO. Vieles hat sich seitdem geändert. Die Sicherheitsphilosophie der NATO, die atomare Abschreckungsstrategie, hatte sich Anfang der 80er Jahre in so deutliche Widersprüche verwickelt, dass nicht nur eine breite Friedensbewegung dagegen aufbegehrte, sondern auch konservative Sicherheitspolitiker Zweifel bekamen. Friedensbewegung und die GRÜNEN forderten folglich den Verzicht auf atomare Waffen und das Ende der Blockkonfrontation. Heute ist der kalte Krieg längst vorbei, der Warschauer Pakt hat sich aufgelöst. Das westliche Bündnis aber besteht immer noch.
Dies ist nicht nur dem Beharrungswillen der Gewinner der Systemkonkurrenz geschuldet. Er allein hätte die tiefe Identitätskrise, in die die NATO zu Beginn der 90er Jahre mangels eines Feindes geraten war, nicht überwinden können. Hinter dem Beharren stand die Einschätzung, dass die Gründungsmotive noch nicht obsolet waren. Gewiss, Deutschland musste nicht mehr niedergehalten werden. Gerade aber das wiedervereinigte Deutschland bedurfte einer Einbindung in internationale Sicherheitsstrukturen, um jeden Gedanken an machtpolitische Verselbständigung unmöglich zu machen und den Nachbarn die Furcht vor dem Koloss in Europas Mitte zu nehmen – ein Motiv das auch bisherige grüne NATO-Kritiker gelten ließen. Im Osten existierte zwar kein definierbarer Gegner mehr, jedoch eine Vielzahl von Transformationsstaaten, die im westlichen Bündnis ihre eigene sicherheitspolitische Zukunft entdeckten – ein Ansatz, der immer noch zu kontroversen Diskussionen führt. Ein entscheidender Grund für die Weiterexistenz der NATO aber lag darin, Nordamerika weiterhin an Westeuropa zu koppeln. Die transatlantische Brückenfunktion wurde auch von Kritikern des Bündnisses nicht verkannt, auch wenn sie nach einer verstärkt zivilen Fundierung durch eine neue transatlantische Agenda suchten – die sich übrigens zu etablieren beginnt.
Als zu Beginn der 90er Jahre die KSZE in die OSZE transformiert wurde, wuchs bei GRÜNEN die – auch programmatisch ausgedrückte – Hoffnung, dass diese Organisation auf der Basis eines erweiterten, primär nicht-militärischen Sicherheitsbegriffs die beschriebenen Funktionen übernehmen und die NATO überflüssig machen könnte. Denn die OSZE überwölbte von Vancouver bis Wladiwostok das transatlantische Verhältnis ebenso wie die ehemaligen Feindstaaten des kalten Krieges, die in der EU integrierten Westeuropäer, die Transformationsstaaten Mittelosteuropas und die Nachfolgestaaten der zerfallenen Sowjetunion. Die zunächst theoretische, wenn auch von nationalen und Großmachtinteressen nicht freie Diskussion über das Verhältnis der beiden Organisationen zueinander erfuhr eine praktische Wendung durch die Jugoslawienkriege. Mit einem unmöglichen Auftrag versehen, wurde die Zivilorganisation UNO – und damit indirekt die OSZE – in eine Auseinandersetzung getrieben, in der sie sich absehbarer Weise nicht behaupten konnte. Manche Beobachter meinen sogar, man habe die UNO geradezu ins Messer laufen lassen, um die NATO als militärisches Instrument zur Krisenbewältigung reetablieren zu können.
Die “neue Nato” verstand es in den folgenden Jahren, sich zum Zentrum der modernen sicherheitspolitischen Diskussion zu stilisieren. Während sie ihre neue Geltung anfangs ausdrücklich damit begründete, in Regionalkonflikten aus humanitären Gründen Beschlüsse des Sicherheitsrates der UNO umzusetzen, rückte sie später von diesem Legitimationsmodell ab. Sobald Nicht-NATO-Staaten im Sicherheitsrat einem NATO-Einsatz die Zustimmung verweigerten, mandatierte sich die NATO selbst auf der Basis von UNO-Resolutionen. Sie eröffnete damit einen Streit um das Völkerrecht, der bis heute nicht gelöst ist und aktuelle Friedensmissionen überschattet.
Die Kosovo-Krise im Oktober 1998 machte nicht nur deutlich, dass die NATO nur deshalb auf den Plan trat, weil in der westlichen Welt die Krisenprävention wieder einmal nicht ernst genommen worden war. Sie zeigte auch, dass der militärische Ansatz, den mancher – auch bei den Bündnisgrünen – schon wieder als einzig wirksames Mittel zu feiern begonnen hatte, an seine Grenzen stieß: wo über das Herbeizwingen eines fragilen Waffenstillstandes hinaus ein selbsttragender Friedens-, Versöhnungs- und Wiederaufbauprozesses in Gang gesetzt und stabilisiert werden musste, waren andere Instrumente und Strukturen gefragt. Hier nun kam plötzlich die OSZE wieder ins Spiel, die mit der größten Mission ihrer kurzen Geschichte den Waffenstillstand überwachen sollte, abgesichert allerdings durch Truppen der NATO.
Aus den praktischen Erfahrungen und den konkurrierenden Interessen der einzelnen NATO-Partner speist sich nun die Diskussion um das neue strategische Konzept des Bündnisses, das auf dem Gipfel in Washington im April 1999 verabschiedet werden soll. Soll die NATO in erster Linie das eigene Territorium oder aber die Interessen des Westens verteidigen? Soll sie sich somit operativ auf das eigene Territorium beschränken oder einen globalen Aktionsradius erhalten? Soll sie an Friedensmissionen teilnehmen; ist dafür ein Beschluss des UNO-Sicherheitsrates nötig oder reichen UNO-Resolutionen oder ist gar die vollständige Selbstmandatierung der NATO erstrebenswert? Kann es einen Verzicht auf den Ersteinsatz von Atomwaffen geben oder soll man sich alle Optionen offenhalten oder einigt man sich auf den Kompromiss, die Wahrscheinlichkeit eines A-Waffeneinsatzes als äußerst unwahrscheinlichen Fall zu definieren? Während die Europäer, besonders das grün geführte Außenministerium, eher die restriktivere Variante anstreben, bestehen die amerikanischen Partner auf der extensiven. Im Extremfall – an dem teilzunehmen aber niemand gezwungen werden kann – könnte dies bedeuten: die NATO verteidigt am Golf (weltweiter Einsatz) die westlichen Energie-Interessen (Défense of interest) ohne UNO-Auftrag (Selbstmandatierung) und schließt den Ersteinsatz von Atomwaffen nicht prinzipiell aus (alle Optionen offen). Die restriktive Position dagegen bedeutet: Die NATO verteidigt sich gegen Angriffe auf ihr eigenes Territorium, hält zur Abschreckung einen Rest an Atomwaffen bereit, nimmt an Friedensmissionen auf der Basis des Beschlusses des Sicherheitsrates teil. Zwischen diesen beiden Polen spielt sich praktisch die interne Kompromissbildung ab. Es scheint, als seien die Europäer, wenn sie geschlossen handeln, in der Lage, allzu weitgehende Ansprüche der USA abzuweisen.
Das Verhältnis der Großorganisationen zueinander wird sich faktisch nicht aus dem Sicherheitsmodell für das 21. Jahrhunderts ergeben, das die OSZE erarbeiten soll. Der ursprüngliche Auftrag schrumpfte auf die Selbstdefinition der OZSE. Sie sollen vielmehr als “interlocking institutions” begriffen werden, als miteinander verschränkte Organisationen, die jeweils ihre komparativen Vorteile bei der Krisenbewältigung zu Geltung bringen sollen. Faktisch bedeutet dieser Modus: da es keine Festlegung auf ein politisches Steuerungsgremium gibt, das über den Einsatz der Organisationen entscheidet, bleibt es der Verhandlungsdynamik zwischen den wichtigsten Nationalstaaten überlassen, wann wo durch welche Organisation und mit welchen Mitteln eingegriffen wird.
In diesem Kräftespiel hat sich eine vierfache Problemstruktur herausgebildet: problematisch ist der Drang der verbliebenen Supermacht USA zum Unilateralismus. Zum zweiten führt der Machtverlust der ehemaligen Sowjetunion oft zu reinen Selbstbehauptungsaktionen gegenüber der unilateralistischen Großmacht in Westen. Dazwischen steht das Dauerproblem der europäischen Nationalstaaten, die bei allem Willen zu einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik oft noch ihren nationalen Eigeninteressen folgen. Als viertes Problem kommen die oft stark betonten Eigenansprüche, die Neonationalismen der MOEs ins Spiel.
Zurzeit ist kein Masterplan zu erkennen, wie die verworrene Struktur von Institutionen, Mechanismen und Interessen in ein rationales Modell überführt werden könnte. Die Dinge werden sich faktisch anhand praktischer Probleme entwickeln. Dass ein grünes Außenministerium versuchen wird, auf der Basis grüner Grundwerte und Programme, eingegrenzt durch die Möglichkeiten und Beschränkungen des Koalitionsvertrages, seinen eigenen Part zu spielen, ist selbstverständlich. Wie schwierig dieses Geschäft ist, dürfte aber diese kurze sicherheitspolitische Skizze anschaulich gemacht haben. Ob die grüne Regierungscrew in der Lage ist, Friedenspolitik durchzusetzen, sollte deshalb nicht nur an programmatischen Ansprüchen gemessen werden, sondern an einer Analyse der objektiven Handlungsbedingungen.
Aber nicht nur die Regierungsseite, auch die Partei kann etwas dafür tun, die Zivilisierung der Außenpolitik weiterzubringen. Aktuell bietet sich die symbolische Ebene an. Denn nicht nur die NATO feiert ein Jubiläum. Deren Drang zur Selbstinszenierung sollte nicht vergessen machen, dass in diesem Jahr andere wichtige Jubiläen anstehen: Die 1974 gegründete KSZE/OSZE wird 25 Jahre, der Völkerbund, Vorläufer der UNO, wurde vor 80 Jahren gegründet, die Zivilorganisation Europarat vor 50. Die Haager Völkerrechtskonvention feiert ihren 100-jährigen Geburtstag. Und nicht zuletzt: vor 20 Jahren wurde auf Betreiben von Helmut Schmidt der NATO-Doppelbeschluss gefasst, als dessen Gegner sich die GRÜNEN gründeten.