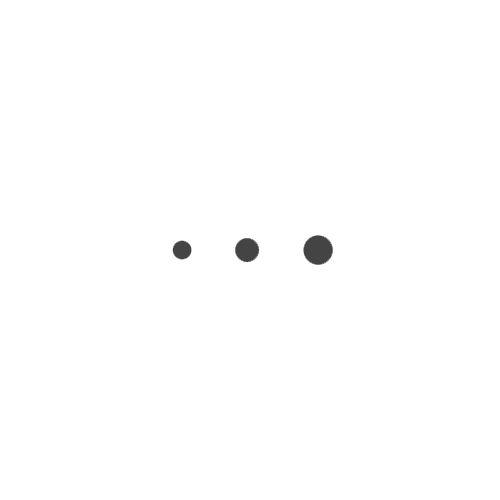(Beitrag für die Frankfurter Rundschau, 07.03.2001)
Politisches Augenmaß – für die Grünen heißt dies, ein Auge peilt die Regierung an, während das andere in den Abgrund schielt. Seit Schröders Kür zum Kanzlerkandidaten der SPD haben die Grünen bei jeder Wahl 3 Prozent verloren. Rot-grüne Wechselwähler, denen bis dahin grüne Oppositionsrhetorik aus dem Herzen sprach, sahen nun in Schröder die Chance auf echten Einfluss. Den Grünen blieb ausgerechnet die Rolle, die sie nie wollten – Mehrheitsbeschaffer für die SPD zu sein. Die verbliebenen 6 Prozent Wähler sind genug zum Regieren, doch zu wenig für ein stressfreies politisches Leben. Daran wird sich so leicht nichts ändern. Schon heute ist die grüne Perspektive für die Bundestagswahl 2002 absehbar: 5 Prozent und erneute Regierungsbeteiligung oder politischer Exitus als Bundespartei. Die Aussicht auf die Oppositionsrolle liegt nahe Null. Würden die Grünen abstürzen, nähme die Gründergeneration ihren Abschied. Trotz einiger jüngerer Talente aber würde ein zweites Comeback nach 1994 kaum gelingen. Es fehlt an Masse, Bewegung und gesellschaftlichem Umfeld. Andererseits kann die Partei nicht nur von der Regierungsrolle leben. Auch wenn ihr Personalangebot qualifiziert und unterhaltsam ist – die bessere Elite zu stellen, bringt noch keine nachhaltige Entwicklung für die Partei. Die Performance in der öffentlichen Eindruckskonkurrenz mag genügend Wählerstimmen bringen, um sich eine weitere Periode in dieser Rolle halten zu können. Wenn sich Darstellung aber von Inhalten löst, wenn jede Botschaft unter dem Aspekt der Mediengängigkeit gleich gültig ist, ist sie auch gleichgültig. Sie verleitet Menschen nicht zu vertiefter Befassung, zu Engagement, zum Mitmachen. Von der Bewegungs- und Milieupartei zur smarten Funktionspartei – diesen Kälteschock würde die grüne Seele nicht überleben. Ohne Verankerung in den sozialen und kulturellen Milieus, ohne politischen Kompass, der die Solidarisierungsrichtung angibt, wird die Partei bei ihren Stammwählern mehr verlieren als sie bei launischer Laufkundschaft gewinnen kann. So stellt sich heute für die Grünen die alles entscheidende Frage: wie ist mittelfristig Regierungsbeteiligung und Regeneration zu verbinden.
In diesen Zusammenhang gehört die Debatte über das Grundsatzprogramm. Sie muss zweierlei leisten: den Kompass einstellen, der über die Regierungspragmatik hinaus den Kurs der Partei anzeigt. Und mobilisieren, erlahmte Kraft aufbauen, neue Kräfte einbeziehen. Kurz: sie muss vertiefen und erweitern. Beides tut sie bisher unzureichend.
Wie nötig der Kompass ist, zeigt ein Beispiel. Man kann ein und dieselbe Steuerreform auf zwei Weisen verkaufen, die Wirkung auf die Wähler könnte unterschiedlicher nicht sein. Rühmt man, wie geschehen, primär die Senkung des Spitzensteuersatzes, wirkt dies – zurecht oder nicht – als Solidarisierung mit den Besserverdienenden. Betont man Freibetrag und Senkung des Eingangssteuersatzes, demonstriert man die Solidarität mit den Normalverdienern. Hier sind in den letzten Jahren Fehler gemacht worden. Zwar ist grünes Renommee in Wirtschaftskreisen gestiegen. Das ist nicht schlecht und beeindruckt auch den Kanzler. Aber erkauft wurde dieser Imagegewinn mit dramatischen Motivationsverlusten bei den Aktiven und Wählern, die grüne Politik mit sozialen Ansprüchen verbinden. Die signalisierte Solidarisierungsrichtung war das Problem. Der Anschein der sozialen Entsolidarisierung wiederum mobilisierte überflüssige Widerstände gegen die Ökosteuer; den Grünen wurde nun jede unsoziale Lastenverteilung zugetraut.
Mancher grüne Stratege mag dabei durchaus im Sinn gehabt haben, die grüne Wählerschaft schlicht auszutauschen. Moderne Liberale sollten die Linken verdrängen, die als altmodisch, quengelig und regierungsunwillig galten. Abgesehen von der Unterschätzung linken Verantwortungsgefühls – auch wenn alle Wirtschaftsführer nun grün wählen würden, es wären weniger als die, die in einer einzigen Ruhrgebietsstadt entsetzt davongerannt sind. Im Pott lebt immerhin ein Zehntel der Wahlbevölkerung. Eine strategische Mittelstandsorientierung der Grünen liefe in dieselbe Falle. Sicher muss der Mittelstand entlastet werden, um Innovation und Arbeitsplätze zu erzielen. Aber den wirtschaftlichen Mittelstand zur Wählerklientel zu befördern, geht ins Auge. Die Mehrheit wird – trotz aller Steuererleichterungen – die Grünen schon deshalb nicht wählen, weil sie ihr zu ausländerfreundlich sind. Für sie scheint Schröders Neue Mitte attraktiver, der Schilys gemäßigte Ausländerpolitik die vermeintliche kulturelle Überforderung erspart. Und den strauchelnden Helden der New Economy liegt nichts ferner als eine sozialethische Begründung ihres Handelns, die für grüne Stammwähler wiederum entscheidend ist. Dabei ist Liberalismus für Grüne kein Fremdwort. Der Bürgerrechtsliberalismus hat seine Heimat längst bei den Grünen statt der FDP. Die grüne Strategie aber, mit der FDP auch im Wirtschaftsliberalismus zu konkurrieren, erlitt wahlpolitisch bereits vor 4 Jahren ihr Waterloo. Bei der dreifachen Landtagswahl gewann die schnittigere FDP die Konkurrenz um die Yuppies.
Die Alternative liegt nicht im linken Traditionalismus. Wer in der Regierungsbeteiligung per se den Verrat erkennt, in der zahlenmäßigen Unterlegenheit eine Charakterschwäche, in Umsatzförderung an sich den Abgesang an soziale Verteilungspolitik, im Grundwertekonflikt zwischen Gewaltfreiheit und Menschenrechten die Kriegstreiberei – sorry, diese Interpretation linker Politik mauert sich im 3-Prozent-Ghetto ein. Zu diskutieren ist vielmehr die Frage: Wie müssen die Selbstgewissheiten von einst unter neuen Bedingungen überprüft werden? Wie können Dogmatismus und Altersstarrsinn vermieden werden, ohne in Beliebigkeit zu verfallen? Biographische Entwicklung bei den Älteren, neues Lebensgefühl bei den jüngeren, verwirrende Themenkonjunkturen, der Dschungel der Medien – hier den grünen Faden zu finden ist die Kunst der Grundsatzdebatte. Es kommt dabei nicht auf Details an. Entscheidend ist das Bewusstsein, dass grüne Klientel sich zwar gehäuft in urbanen Zentren findet, oft Human- und Sozialdienstleistungen nachgeht, überdurchschnittlich gebildet ist und einen welt- und erfahrungsoffenen, libertären, ökologisch sensiblen Lebensstil pflegt, dass sie aber von anderen Teilen der Mittelschichten, besonders von FDP-Anhängern, durch eines markant unterschieden ist: ihr soziales Grundverständnis und ihre ethische Orientierung!
Das gilt auch für die Jüngeren. Dass sie unter grünen Talaren nicht den Muff von 20 Jahren spüren wollen, widerspricht nicht ihrem Verständnis von Verantwortung. Vieles, das den Grünen früher Hohn einbrachte, ist heute selbstverständlich. Das neue Lebensgefühl sucht neue Strukturen, offene, die zu experimenteller Politik einladen, abseits von Kreisverbandssitzungen, wo die Details von Ratstagesordnungen durchgekaut werden. Die Partei muss wieder entdecken, dass Fun und Verantwortung sich eben so wenig ausschließen wie Lebensfreude und Politik.
Bei der Grundsatzdebatte ist das Ergebnis deshalb weniger wichtig als eine vertiefende und mobilisierende Diskussion über die Partei hinaus. Auch bei der Fusion von Bündnis 90 und Grünen war der Prozess selbst das entscheidende. Das Produkt, der „Grundkonsens“, lagert wie vorausgesehen im Museum. Die jetzige Diskussion wird mitentscheidend sein für die Frage, ob die Grünen mit ihren ökologischen, sozialen, radikaldemokratischen, pazifistischen und feministischen Traditionen wirklich eine „langlebige gesellschaftspolitische Grundströmung“ sind oder aber nur ein Generationsprojekt, das mit der 68er-Kohorte verschwindet.