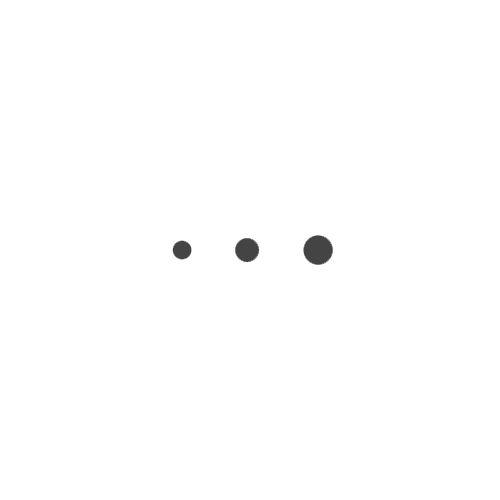(erschienen am 27. Juli 1991 im „Freitag“. Nachdem die Grünen 1990 aus dem Bundestag ausgeschieden waren, kam es 1994 auf das Comeback an. Zugleich aber konnte eine rot-grüne Mehrheit nicht ausgeschlossen werden. Diesem Szenario, das dann 1998 akut wurde, widmet sich der Essay.)
Die Grünen sind keine sozialdemokratische Zweitpartei
Brauchen wir die GRÜNEN noch? Was unterscheidet sie von der SPD? Was heißt heute grünes Profil? So lauten die Standardfragen zur Zukunft der GRÜNEN. Verbalradikalismus und flotte Sprüche reichen da als Antwort nicht hin. Ebenso wenig aber ist es zwingend, nun ins andere Extrem zu fallen, gemessenen Schrittes neugewonnene Reputierlichkeit zur Schau zu stellen und darauf zu hoffen, dass dies einen Seitenstrom der Sozialdemokratie so weit beeindruckt, dass er sich in Zukunft bevorzugt bei den GRÜNEN anlagert.
Sollen die GRÜNEN sich eigenständiger Zielsetzungen enthalten und fürderhin nur noch als Juniorpartner der SPD auftreten? Sind die GRÜNEN und die SPD tatsächlich zwei Varianten derselben Politik? Jüngere Zeitgeschichte, Wertehintergrund und Programmdesign legen andere Schlüsse nahe.
Die Erwartung, dass des Kanzlers Taumeligkeit, Mümmelmanns Hakenschlagerei (gemeint ist der FDP-Politiker Jürgen Möllemann, LV 2021) und der Parforceritt der Sozis durch die deutschen Ländereien den Ausbruch eines zweiten sozialdemokratischen Zeitalters signalisierten, hat viel Empirisches auf ihrer Seite. Aber Sozialdemokratie gab es noch nie pur. Der Koalitionspartner bestimmt die Akzentuierung. Heute, wo es um den ökologischen Umbau der Ökonomie geht, ist die Lage völlig anders als in den ausgehenden Sechzigern: den produktivitätshemmenden Mief der Adenauerära wegblasen und die kulturrevolutionären Gehalte der APO nutzbar machen, um durch die Erschließung neuer Märkte auf der Grundlage freigelegter Bedürfnisse ein stagnierendes Wachstum wieder anzukurbeln – das war die Stunde der Sozialliberalen. Ihr Modernisierungskonzept stieß auf Interesse. Die lebensweltlichen Träume der Rebellion wurden zunächst ebenso bedient wie die Lohnerwartung der klassischen Industriearbeiterschaft und die Karriereambition des neuen Managertyps. Jedenfalls solange verschärftes Wachstum noch nicht auf den Widerstand einer Ökologiebewegung stieß oder in der Ölkrise versoff.
Der im selben Rhythmus swingende freudvolle Hedonismus aller sozialer Schichten kippte um in Katzenjammer, als Mitte der Siebziger Ölpreis und Ökokrise das Ende des Wachstumswahns anmahnten. Zwar kam es zur Verblüffung der florierenden K-Gruppen wieder mal nicht richtig zum Klassenkampf. Aber immerhin schaffte es die ÖTV (heute Teil von Verdi, LV) mit hohen Lohnforderungen, ihrer Klientel einen Nutzen zuzufügen, die Mittel für die ambitionierte Sozialpolitik des Reformkanzlers Brandt zu schmälern und als Verwalter des zukünftigen Mangels den Krisenmanager Schmidt auf den Sockel zu heben. Brandt, Klunker, Schmidt – schon damals war Sozi nicht gleich Sozi. Selbst Brandt war nicht gleich Brandt: als seine Forderung nach mehr Demokratie an seinen Berufsverboten zerschellte, war nach dem sozialen auch der liberale Anteil des Projektes erledigt. Und als Schmidt die neue ökologische Frage, die Diskrepanz des Wachstumswahns zu den ins Auge springenden Nöten der Umwelt, als Spinnkram abtat, trieb dies eine grüne Partei hervor.
Seitdem sind die Jahre ins Land gegangen. Was den GRÜNEN damals als Abgrenzung zur SPD diente, ist heute nicht mehr ohne weiteres gültig. Augenscheinlich hat es Wandel gegeben: im gesellschaftlichen Bewusstsein, in der Politik der GRÜNEN, in der Politik der SPD. Das Verhältnis der beiden Parteien zueinander definiert sich heute nicht primär aus dem evidenten Versagen der einen in den Siebzigern, sondern aus dem spezifischen Bezug beider auf die geänderten politischen, ökonomisch-ökologischen und soziokulturellen Gegebenheiten der neunziger Jahre.
Neuer Wohlstand und alte Armut
Die gesellschaftliche Blindheit gegenüber der ökologischen Krise ist dem allgemeinen Bewusstsein für die natürlichen Lebensgrundlagen gewichen. Dass andere Parteien die ökologischen Denkanstöße der GRÜNEN zum Teil aufgenommen haben, sollte aus grüner Sicht nicht bejammert werden. Es ist der Ausdruck eines beginnenden Wertewandels in der Gesellschaft, den die GRÜNEN mit angestoßen haben. Breiten Teilen der Mittelschichten genügt der erreichte materielle Wohlstand. Sie wollen gar nicht unbedingt mehr. Was sie wollen, ist weniger Stress, mehr Freizeit, mehr Muße, weniger Konkurrenz und Hetze, mehr Lebensgenuss. Die Mittelschichtsfrauen fordern die Wahl zwischen variablen Lebensentwürfen. Wachstum als ökonomische Zielgröße macht vor dem postmaterialistischen Wertehintergrund keinen Sinn mehr. Das Bewusstsein, dass jede mehr verdiente Mark mit dem Verlust von Lebenswelt, mit der Zerstörung dessen, was mensch genießen möchte, erkauft werden muss, macht materielle Wohlstandssteigerung immer fragwürdiger.
Dies scheint das Neue in der Gesellschaft; doch die alten Konfliktmuster sind deshalb nicht suspendiert. Für ein Drittel – im Westen vielleicht weniger, im Osten deutlich mehr – steht nach wie vor die soziale Frage im Vordergrund. Es gibt objektiven Nachholbedarf. Die Forderungen nach Verteilungsgerechtigkeit, nach Verbesserung der Lebenschancen, nach Abbau struktureller Armut, nach eigenständiger ökonomischer Existenzfähigkeit der Frauen bleiben dringlich und legitim. Sie sind für eine fortschrittliche Politik nicht zu vernachlässigen, nur weil die versorgten Zweidrittel sich auf ihrer Wohlstandsbasis einen Wertewandel leisten können. Zum eigenständigen Stellenwert der sozialen Frage kommt noch eine gesellschaftsstrategische Überlegung: Zwar sind auch breite Teile der armen Schichten sehr sensibilisiert für ökologische Probleme. Solange sie aber den tagtäglichen Kampf um Arbeit und Brot zu führen haben, fallen sie als Bündnispartner für eine Ökologisierung der Gesellschaft aus.
Wenn diese beiden sozialen Schichten – alte Arme und neue WohlstandsbürgerInnen – und in ihnen in besonderer Weise die Frauen das markanteste Interesse an grundlegenden Änderungen von Gesellschaftsstruktur und Lebensweise verspüren, dann muss es Aufgabe fortschrittlicher Politik sein, diese Kräfte so zu bündeln, dass sie für eine Strategie der Transformation auch wirksam werden können.
ökologisch-sozialer Gesellschaftsvertrag
Vor der Frage nach politischen Koalitionen steht deshalb die nach dem gesellschaftlichen Bündnis, das das liberalkonservative Projekt der Zweidrittelgesellschaft ablösen will. Eine fortschrittliche, d.h. ökologische, soziale und feministische Politik muss sich daran messen lassen, inwieweit es ihr gelingt, die berechtigten Ansprüche beider, die postmateriellen der neuen Mittelschichten auf mehr Lebensqualität und die materiellen der armen Schichten auf Wohlstandssteigerung, zu vermitteln. Verlangt ist ein ökologisches Umverteilungsprojekt. Der Verzicht der Neuen Mittelschichten auf weiteren Zuwachs und die Abschöpfung übergschüssigen Reichtums können ökologische und soziale Umbauprozesse finanzieren, die gleichermaßen die soziale Lebenslage der armen Schichten verbessern und allen ein Mehr an ökologischer Lebensqualität bieten. Dieser Gesellschaftsvertrag zwischen alten Unter- und neuen Mittelschichten gründet nicht mehr auf dem Postulat pauschalen Wachstums. Er erfordert eine Umverteilung aus der vorhandenen Reichtumssubstanz. Insofern stellt er die klassisch linke Frage nach Umverteilung erheblich radikaler als traditionelle sozialdemokratische oder linkssozialistische Theorien, die allesamt wachstumsgebunden sind.
Das Zusammendenken materieller Nachholbedürfnisse mit postmateriellem Lebensgenuss hat gesellschaftlich erheblich zugewonnen, ist aber insgesamt noch minoritär gegenüber unsozialen und unökologischen Haltungen. Dennoch hat sich die Interessenbasis aller Linksparteien dadurch verschoben. Sie reagieren konzeptionell und programmatisch recht unterschiedlich auf die neue Chance.
Interessenanalyse und Parteienkonkurrenz
Auch wenn dieses Konzept bei den GRÜNEN theoretisch vor allem im „Linken Forum“ entwickelt wird, kann es als Konsens der gesamten Partei gelten. Dass die postmateriellen Werthaltungen in keiner anderen Partei so stark ausgeprägt sind und einzelne Mitglieder an ihrer yuppiemäßigen Selbstkarikierung arbeiten, darf nicht zu der Fehlinterpretation verleiten, die GRÜNEN seien nichts weiter als die Partei der neuen Mittelschichten. Das „ökologische und soziale Umbauprogramm“, das Konzept für „eine ökologisch-solidarische Weltwirtschaft“, das „Antidiskriminierungsgesetz“, die grünen Alternativentwürfe zum Stabilitäts- und Wachstumsgesetz und zum Bruttosozialprodukt als Wohlstandsindikator, die in Entwicklung begriffenen Ansätze ökologischer Regionalpolitik für die neuen Länder – diese Konzepte sind allesamt Paradebeispiele für die Integration von Armutsbekämpfung und Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen. Ähnliche Grundhaltungen finden sich bei den Bürgerbewegungen des BÜNDNIS 90, weshalb ihr Zusammengehen mit den GRÜNEN viel Sinn macht.
In der SPD ist die reine postmaterielle Grundhaltung eher marginal. Doch hat die vermittelnde Einstellung erheblich an Terrain gewonnen. Noch aber befindet sie sich in der Minderheit gegenüber den Vertretern materieller Klientelinteressen aller sozialer Schichten. Der Klientelismus wird durch den grün-alternativen Diskursdruck in Schranken gehalten, nutzt aber in aggressiver Weise jede Gelegenheit zum Durchbruch. Dabei werden auch die umweltpolitischen Ansätze wieder zur Disposition gestellt. Verstärkt wird dieser Effekt dort, wo die SPD-Regierungspolitik betreibt. Von daher hat die SPD kein umfassendes und kohärentes Konzept ökologischer Umverteilung. Es existieren umweltpolitische Programmpunkte und gleichzeitig der Glaube an einen kaum gebremsten industriellen Produktivismus. Die nachsorgende Umwelttechnik der SPD ist fast das Gegenprojekt zur Politischen Ökologie der GRÜNEN. Die ökologischen Ansätze auf dem linken Parteiflügel werden sich nur entfalten können, wenn sie in Verhandlungen mit den GRÜNEN eine Scharnierfunktion bekommen.
Die kleineren Linksparteien und Projekte wie PDS oder Ökologische Linke versuchen Ökologie mit „proletarischer“ Politik zu verknüpfen; für die PDS ist das ökologische Element aufgesetzt, für die ÖL das arbeiterbewegte. Das beide verbindende Motiv eines bekennenden Antikapitalismus bleibt zu abstrakt und defensiv, um in wirksame gesellschaftspolitische Strategien münden zu können. Dennoch: im Kontext außerparlamentarischer Gegenmacht könnten sie für eine Transformationsstrategie eine Rolle spielen. Eine Kandidatur dagegen für den Bundestag, ohne die geringste reale Chance auf einen neuen Einzug, hätte eine objektiv reaktionäre Funktion: die GRÜNEN unter 5% zu drücken und das Dreiparteiensystem zu stabilisieren.
Szenario 1994
Die Zeit ökologischer Expressivität ist vorbei, die Zeit, als das „Darstellen von Inhalten“ allein schon Politik war. Wenn sich im Koordinatenkreuz von Wertewandel und Solidarpolitik eine neue gesellschaftliche Kraftbasis gebildet hat, die die Durchsetzung einer ökologisch-sozialen Umverteilung denkbar macht, dann stellt sich die Frage nach dem politischen Bündnis. Bei allen historischen und konzeptionellen Unterschieden finden GRÜNE und SPD doch zu einem nicht unbedeutenden Anteil eine gemeinsame gesellschaftliche Basis. Sie können ein politisches Bündnis eingehen, das dem gesellschaftlichen zur Teilhabe an der Staatsmacht verhilft. Doch keine Illusion! Reichweite und Grenze einer Koalitionspolitik liegen weit unter dem Wünschenswerten.
Grüne Politik wird in Zukunft auf dieser Folie interpretiert werden müssen. Ein Zurück zu den Anfängen wird es nicht geben. Die sozialen Bewegungen der siebziger Jahre sind abgeflaut, haben sich institutionalisiert. Die BürgerrechtlerInnen der ehemaligen DDR machen den gleichen Prozess in größerer Rasanz durch. Die Akteure von damals sind heute nicht mehr die AktivistInnen der Straße; aber sie haben die Lebenswelten durchsetzt. Sie sind die Fermente, die etwas in Gärung versetzen. Grüne Politik muss ihre Interessen heute anders vertreten als damals. Ihr Sprachrohr sein zu wollen, ist heute zu wenig ambitioniert. Sie wollen eine Teilrealisierung ihrer Interessen erleben.
Das entbindet die GRÜNEN zugleich vom Reinheitsgebot. Die Lehre pur, die unbefleckte Weste, die politische Unschuld erscheinen immer mehr als Zeichen mangelnden Durchsetzungswillens. Wenn dem so ist, dann dürfen umgekehrt die GRÜNEN zumuten. Sie müssen ihrer Anhängerschaft zumuten, Diskrepanzen auszuhalten, Zielkonflikte zu akzeptieren, Niederlagen nicht als Verrat zu werten. Mehr noch, sie müssen sich offensiv mit denen auseinandersetzen, die die Partei – ohne Analyse ihrer realen Handlungsspielräume – in eine Koalition hineinwünschen, sie aber verfluchen, wenn sie dort als schwächere Partnerin fatale Entscheidungen mittragen muss.
In einer rot-grünen Regierungskoalition kommt nicht nur der Kompromiss zwischen alten Unter- und neuen Mittelschichten zum Ausdruck. Beide zusammen sind gesellschaftlich immer noch in der Minderheit. Über die 50%-Mehrheitsgrenze werden sie nur getragen, wenn die Sozialdemokratie Kräfte aus der rechten Mitte mitzieht. In der rot-grünen Arithmetik rechnet sich Engholm und nicht Lafontaine. Die rechte Mitte lässt sich das Votum für die SPD durch einen harten Kurs den GRÜNEN gegenüber honorieren. Für die GRÜNEN als kleinerer Partnerin wird die strategische Chance unweigerlich eine Menge unangenehmer Kompromisse bis hin zu herben Niederlagen mit sich bringen.
Es gibt nur zwei Alternativen: eine Reinheit, die nichts aber auch Garnichts durchsetzt. Wo nicht mehr die Propagierung, sondern die Umsetzung ökologischer Politik auf der Tagesordnung steht, trägt ein prinzipielles Verharren in der Oppositionsrolle nicht weit. Oder ein Hineinwühlen in den Modder mit der Hoffnung, dass der politische Saldo positiv ausfällt; wenn nicht – dann schlammverkrustet wieder raus.
Die Gesellschaft hat den GRÜNEN die Entscheidung längst abgenommen. Das konservative Projekt der Zweidrittelgesellschaft abzulösen, wird zu einer dermaßen starken Verpflichtung, dass kleinliche Maßstäbe nicht mehr greifen, wenn grüner Erfolg gemessen werden muss. Das heißt nicht Abschied von Programmpunkten nehmen. Im Gegenteil. Aber die Programme dürfen nicht zelebriert, sie müssen investiert werden in praktische Durchsetzungsprozesse. Dort muss der Mut aufgebracht werden, Federn zu lassen, wenn strategisch dadurch neue gesellschaftliche Optionen eröffnet werden.
Es gibt nur zwei Lösungen für das Dilemma, radikale Vorstellungen in einen engen institutionellen Rahmen einspeisen zu müssen. Das Rangeln um Formeln, Klauseln und Grenzwerte; jeden quantitativen Unterschied, der der SPD abverhandelt wurde, als grünen Sieg ausgeben. Das gelingt am besten, wenn das grüne Kabinettsmitglied gleichzeitig ParteisprecherIn ist und die Identität seiner Regierungspolitik mit grünen Zielen beteuert. In dieser Sicht ist es praktisch, die grünen Programme nur als Varianten der sozialdemokratischen zu sehen. So wird die Diskrepanz zwischen politischen Zielen und Durchsetzungschancen einfach wegdefiniert. Die große Vision wird auf Verwaltungsniveau kleingearbeitet; der gesellschaftspolitische Gehalt und damit Motivation und Drive gehen aber unweigerlich verloren. Die Alternative lautet: die GRÜNEN holen im Kabinett, was zu holen ist. Die Partei aber – personell unabhängig von Kabinett und Fraktion – fixiert sich nicht auf diese Ebene, verliert das eigentliche Ziel globaler ökologischer und sozialer Umwälzungen nicht aus dem Blick, engagiert sich in der ständigen Mobilisierung gesellschaftlicher Gegenmacht und setzt notfalls die eigene rot-grüne Regierung unter Druck.
Wie auch immer die GRÜNEN mit diesem Dilemma umgehen wollen, entrinnen können sie ihm nicht. Die Entscheidung für den mutigeren Weg bedeutet die eigenständige Politikfähigkeit zu erweitern, die eine Selbstbescheidung auf die Rolle einer Juniorpartnerschaft überflüssig macht. Nur mit dem klaren Bekenntnis, auch weitergehen zu wollen, werden die GRÜNEN wenigstens wieder in den Bundestag kommen. Das allein aber ist lebensrettend. Ohne Wiedereinzug ist die grüne Partei und damit radikal ökologische Politik überhaupt ein Auslaufmodell, für das auf die nächsten zehn, zwanzig Jahre keine Nachfolge in Sicht ist. Alles oder nichts, Bereitschaft zur Beteiligung an der Staatsmacht oder völliges Scheitern. So krass scheint sich für alle Linken, nicht nur für die GRÜNEN 1994 die Alternative zu stellen.