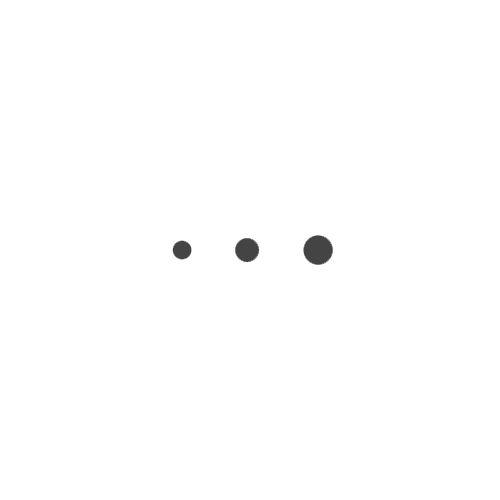Von der katholischen Jugend über die Basisgruppen zu den Grünen
Noch herrschte die graue Kargheit der Nachkriegszeit, als ich 1952 in Gelsenkirchen zwischen Zechen und Kokereien in einer Genossenschaftssiedlung der katholischen Arbeiterbewegung als ältestes von vier Geschwistern geboren wurde. Mein Migrationshintergrund war längst verblasst. Vier Generationen zuvor waren die deutsch-polnischen Ahnen aus Ostpreussen, Oberschlesien, dem Münsterland und der Eifel ins Ruhrgebiet gezogen, um sich im Bergbau ein besseres Leben zu erarbeiten. Ihre Spuren reichen zurück bis ins Jahr 1615: fast alle waren arme und einfache Leute gewesen. Manch einer hatte erfolgreich gegen die Leibeigenschaft und für einen eigenen Hof gekämpft. Andere waren in die USA oder nach Brasilien ausgewandert.
Mutter Maria-Theresia, geborene Saager, war Säuglingsschwester, praktizierte aber, dem konservativen Zeitgeist und der religiösen Überzeugung folgend, als Hausfrau. Vater Günter Volmer hatte als Soldat heftige Schlachten an Ost- und Westfront überlebt und sich nach Ausbildungen zum Landarbeiter und Chemielaboranten über Sonderprüfungen zum angestellten Chemieingenieur hochgearbeitet. Sie waren, wie die Großeltern, im „Dritten Reich“ keine Nazis gewesen, sondern hatten ihr katholisches Gemeinde- und Verbandsleben in der Illegalität weitergeführt. Die enge Wohnung mussten wir anfangs mit Ausgebombten teilen, das Einkommen war knapp. Straße, Gärten und Trümmergrundstücke boten dem Nachwuchs Raum für Forschung und Entwicklung.
Nachdem Vater, der seit 1950 für die CDU dem Stadtrat angehörte, 1966 in den Landtag und 1969 in den Bundestag einzog, besserte sich die materielle Lebenslage, ohne dass Reichtum ausbrach. Honoratioren und Funktionäre aus Kirche und CDU, Katholischer Arbeiterbewegung und Christlichem Gewerkschaftsbund gingen bei uns ein und aus.
Kirche, Schule & Sozialarbeit
Die christlichen Arbeiter verfolgten das Ziel des sozialen Aufstiegs nicht wie die sozialistischen als kollektive Klasse, sondern über die biblisch angeratene individuelle Talentförderung. Bildung war das wichtigste – neben Frömmigkeit. Es war ein „gutes Elternhaus“, fürsorglich und mit „Herzenswärme“; doch das erzkonservative CDU-Milieu engte ein. Als weiterbildende Schule kam auf Rat des Pfarrers nur das humanistische Schalker Gymnasium infrage, mit viel Latein und Alt-Griechisch. „1968“ brachte alles durcheinander – ich wurde Mitläufer im bundesweit ersten Schulstreik. Den Rektor fanden wir reaktionär und die Schule zu elitär. Immerhin gelang der Einstieg in die Außenpolitik. Der Kunstlehrer dozierte: „Eine deutsche Division nach Vietnam und der Vietkong sitzt auf dem Fujiyama.“ Die Klasse verweigerte die traditionelle Abiturfahrt nach Hellas, das von Faschisten beherrscht wurde. Stattdessen ging es ins „swinging London“.
Neben der Schule sollten der Dienst als Ministrant und die „Katholische Jungmännergemeinschaft (KJG)“ Halt und Orientierung geben. Doch mit dem 2. Vatikanischen Konzil kam auch der „kritische Katholizismus“. Wir katholischen Jugendlichen suchten nun die Begegnung mit den evangelischen, statt uns weiterhin mit Steinen zu bewerfen und gründeten 1969 den „Ökumenischen Arbeitskreis Ückendorf“. Wir wollten „nicht nur beten, sondern Gutes tun“, schrieb ich in meinem ersten Flugblatt.
So gingen wir in eine slum-ähnliche Obdachlosensiedlung mit planungsverdrängten kinderreichen Familien am Gemeinderand am Fuße einer Abraumhalde, organisierten Hausaufgaben- und Spielnachmittage und versuchten, die Erwachsenen zur Revolte gegen die Stadtverwaltung zu motivieren. Mit meinem Freund Uli Kaminski schlug ich an Kirchentüren Thesen gegen die soziale Indifferenz der Gottesdienstbesucher an. Ohne es zu wissen, waren wir Akteure der „Randgruppenstrategie“, die Herbert Marcuse, ein Philosoph der 68er-Bewegung, gerade beschrieb. Wie er prophezeite, lernten wir viel über Armut und Unrecht im Wirtschaftswunderdeutschland und fühlten uns bald „links“. Wir nannten uns nun „Team 71“, bekamen scharenweise Zulauf und wurden zu einem Kern der Gelsenkirchener „Szene“. Als solche kümmerten wir uns auch um den Erhalt von Arbeitersiedlungen, kämpften für ein Jugendzentrum, die Interessen von Lehrlingen, die Betreuung von Nichtsesshaften und widmeten uns der Integration türkischer „Gastarbeiter“, einschließlich der Bekämpfung ihrer Grauen Wölfe. Der „summer of love“ wirkte noch nach, das Musical „Hair“ ließ die Haare wachsen, und bald reihte ich mich in Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg ein. 1974 hatte das Team 71 sein Ziel erreicht: „Unser“ Slum wurde aufgelöst, und die Familien wurden mit ordentlichen Wohnungen versorgt. Zahlreiche Aktivisten von damals nahmen später für die Grünen kommunalpolitische Mandate wahr.
Studium und Basisgruppen in Bochum
Nach dem Abitur 1971 war ein Studium der Sozialwissenschaft und Pädagogik an der Ruhr-Universität Bochum naheliegend. Die spätere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth war meine erste Dozentin, bei den SoWis erlebte ich noch den großen Urs Jaeggi und den Kampf gegen Nazi-Professoren. Nach zwei Semestern wurde ich nach staatlicher Gewissensprüfung als Kriegsdienstverweigerer zum zivilen Ersatzdienst in einem Bochumer Krankenhaus eingezogen. 1974 zurück an der Uni und nun Bewohner einer Gelsenkirchener WG, fühlte ich mich bald vom dogmatischen politischen Furor der stark gewordenen maoistischen K-Gruppen genervt, der, gemessen an meinen Slum-Erfahrungen, jeden Realitätssinn vermissen ließ. In Karl-Heinz Lehnardt fand ich einen Gleichgesinnten. Wir begannen, an der SoWi-Abteilung „undogmatische Linke“ zu sammeln, die weder Peking noch Moskau noch den als spießig empfundenen heimischen Arbeiterorganisationen folgen, sondern „politische Arbeit mit persönlicher Emanzipation verbinden“ wollten.
Selbstverständlich lasen wir Marx und Engels. Ihre Kritik der politischen Ökonomie öffnete die Augen und ihre Frühschriften boten ethische Orientierungen. Ihre politische Theorie von der unausweichlichen Revolution durch die Arbeiterklasse leuchtete mir jedoch nicht ein. Und wie andere fand ich, dass der von Hindenburg und Ludendorff geförderte Lenin, seine Genossen Trotzki und Stalin nicht nur Verbrechen am russischen Volk, sondern auch am Marx’schen Werk begangen hatten. Wir orientierten uns lieber an der „Kritischen Theorie“ der Frankfurter Schule und an den historisch-hermeneutisch arbeitenden Sozialphilosophen Ernst Bloch und Leo Kofler, zwei frühen DDR-Dissidenten. Kofler begutachtete später neben dem Sozialpsychologen Helmut Nolte meine Diplomarbeit. Bald kamen die zeitgenössische feministische Literatur und andere progressive DenkerInnen hinzu. Den Wert der empirisch-analytischen Verfahren des „Kritischen Rationalismus“, die uns in Bochum eingebläut wurden, lernte ich erst in meiner späteren Berufspraxis schätzen.
1976 kandidierten wir „Undogmatischen“ als „Basisgruppe“ für den Fachschaftsrat – gegen die langjährigen Platzhirsche der K-Gruppen. Wir gewannen und bildeten eine Blaupause für ähnliche Gruppen, auch an anderen Unis. Bald hatten wir, vermengt mit eigentlich geschmähten K-Gruppen-Leuten, dem CDU-Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) die Mehrheit im Studentenparlament und den AStA abgenommen. Wegen der K-Leute scheiterten wir und gewannen ein Jahr später als links-alternative „Basisgruppen“ pur.
Das SoWi-Diplom und die Annahme als Doktorand in der Tasche, fiel mir 1979 die Rolle des Chefredakteurs der Bochumer Studentenzeitung (BSZ) im „linken Koalitions-AStA“ zu. Bei der nächsten Wahl holten die Basisgruppen die absolute Mehrheit; bis heute dominiert in Varianten die undogmatische Basislinke. Viele von uns bekleideten später bei den Grünen wichtige Positionen; einstige Uni-Bündnispartner der Jusos und Jungdemokraten, auch einige vom MSB-Spartakus, trafen wir in der Landes- und Bundespolitik wieder. Die maoistischen Gruppen indes verschwanden, nicht ohne mich wegen unproletarischer „Rechtsabweichung“ aufs schärfste zu verurteilen, was ich noch bei den Grünen, wo sich viele K-Gruppen-Häuptlinge einfanden, zu spüren bekam. Während ihnen Mitte der 1970er Jahre die zu Revolutionen verklärten Massaker der Roten Khmer in Kambodscha nicht blutig genug sein konnten, waren ihnen später bei den Grünen selbst Ex-Basisgrüppler zu radikal – das „K-Gruppen-Paradox“.
Wir unterstützten aus der Uni heraus den anwachsenden Bürgerprotest, besonders die Anti-AKW-, die Ökologie-, Alternativ-, Friedens- und Neue Frauenbewegung, aber auch DDR-Dissidenten und Befreiungsbewegungen in der „Dritten Welt“. Gegner war faktisch die SPD von Helmut Schmidt. Nachdem diese über ein neues Hochschulrahmengesetz das „allgemeinpolitische Mandat“ der „verfassten Studentenschaft“ durch ein begrenztes „hochschulpolitisches“ ersetzt hatte, wurde die Hochschulpolitik öde. In einem BSZ-Essay erklärte ich: „Die Hochschule als Ort der Vernunft ist tot“ und rief zum Engagement in den Bürgerinitiativen auf.
Immer wieder kam die Diskussion über eine neue, von Moskau und Berlin-Ost unabhängige Partei links von der SPD auf. Drei „Sozialistische Konferenzen“, an denen auch wir Links-Alternative teilnahmen, führten zu keinem befriedigenden Ergebnis. 1979 standen Europawahlen an, und der „bürgerliche Protest“ liebäugelte mit einem „parlamentarischen Arm“. Endlich gab es die „Massenbasis“ für eine neue Partei. So gründete sich die „Sonstige politische Vereinigung (SPV) Die Grünen.“ Auf Bundestreffen der Basisgruppen plädierte ich energisch für diese „Wahlbewegung“ und trat selbst der Bochumer Initiative bei. Orientierend für viele „undogmatische Linke“ wurde auch das Buch „Politik zwischen Kopf und Bauch“ – unsere Diplom-Arbeit -, mit dem Karl-Heinz Lehnardt und ich den theoretischen Bruch mit dem K-Gewese zugunsten selbstbestimmter Basisinitiativen fundierten. (Kalle verunglückte kurz darauf bei einem Autounfall tödlich.) Die „Basisgruppen“ wurden zu einem der großen Gründungsströme der Grünen.
Globetrotter
Die 1960er, 70er und 80er Jahre bestanden nicht nur aus Politik, sondern auch aus Vereins-Sport und Reisen. In der Tischtennisabteilung von Schalke 04 brachte ich es sogar zum Funktionär – einige Monate Schriftführer im Jobsharing mit Bruder und Freund. Später folgte Ligasport im Volleyball und Fußball. Die alte Neigung zu Schalke 04 sollte Abstiege und Niederungen überdauern.
Wichtiger noch waren ab 1971 Tramp- und Backpacking-Touren durch ganz Europa, den Ostblock bis auf Plattensee, Prag und Jugoslawien ausgenommen, aus denen sich ein Netzwerk von Freundschaften entwickelte. In Ost-Berlin besuchte ich einmal jährlich Brieffreunde, bis wir Grünen dort 1984 Einreiseverbot erhielten. In den portugiesischen Nachrevolutionswirren von 1976 fand ich Freunde, die im Kampf gegen den Faschismus und die Kolonisierung in Afrika Leben, Gesundheit und Freiheit riskiert hatten, und lernte von ihnen den Ernst des politischen Lebens kennen. Unsere WG dort war zugleich konspirative Anlaufstelle für (illegale) Abtreibungen.
Ab 1978 erkundete ich den Rest der Welt, erst Westafrika, dann Ostafrika, wo mit der erfolgreichen Besteigung des Kilimandscharos auch die Lust am Bergsteigen begann. Noch kurz vor der Wahl in den Bundestag wanderte ich 1982 wochenlang den klassischen Anmarschweg der großen Himalaya-Expeditionen von Kathmandu zu einem Gipfel über dem Base Camp des Mount Everest. Die oft abenteuerlichen Reiseerfahrungen bildeten eine lebendige Basis für die spätere Arbeit in der Außen- und Entwicklungspolitik.
Folgenreicher Start ins Arbeitsleben
Nach wissenschaftlichen Jobs an der Uni, an Volkshochschulen und in der empirischen Sozialforschung nahm ich 1980 in Gelsenkirchen eine Stelle am „Institut für Wohnumfeldverbesserung“ an, das zum Kommunalverband Ruhrgebiet gehörte. Hier ließ mich eine Landschaftsarchitektin ihre Entwürfe für die Rekultivierung der großen Bergehalden im Pott einsehen – eine Chance, die Rhein-Elbe-Halde in meinem Heimatstadtteil mitzugestalten. Hauptsächlich sollte der Kollegenkreis Freizeit- und Begegnungsmöglichkeiten entwickeln, damit eine im florierenden Revier angeblich anstehende Arbeitszeitverkürzung nicht zu Müßiggang führe. Es kam anders, nichts florierte, sondern mit dem Untergang von Kohle- und Stahl-, Textil- und Glasindustrie hinterließ der Strukturwandel einen gehörigen Flurschaden. Später trugen Ideen, die in unserem abenteuerlichen Brainstorming geboren worden waren, zum Aufbau des Tourismus im Ruhrgebiet bei, etwa Radwege entlang der Wasserstraßen oder Kulturstätten in Industrieruinen.
Eine andere Aufgabe sollte entscheidend für meinen weiteren Lebensweg werden. Zusammen mit zwei KollegInnen bekam ich den Auftrag, ein Sanierungsgutachten zu verfassen, um in einer Revierstadt eine zentrumsnahe Arbeitersiedlung, in der zahlreiche türkische Familien wohnten, abreißen und durch moderne City-Häuser für die gehobene Mittelschicht ersetzen zu können. Wir sollten „besondere Wohnungswünsche“ türkischer Familien ermitteln, letztlich zu deren Umsetzung in eine Stadtrandsiedlung – vergleichbar vielleicht mit meinem ehemaligen Obdachlosen-Slum, zudem garniert mit Grillplatz für Hammel und Schwatzplatz für Frauen? So zumindest lautete der damals aktuelle Stand der „wohlmeinenden“ Vorurteile. Wir lehnten die Aufgabe als rassistisch ab, wurden mit Entlassungsdrohung gezwungen zu liefern, organisierten im Sanierungsgebiet heimlich eine Bürgerinitiative gegen uns selbst, die den Abriss verhindern sollte und kamen in unserem Gutachten zum Ergebnis, die Siedlung müsse erhalten und mietergerecht modernisiert werden. Das besiegelte unser Ende im Institut. Wir wurden langzeitarbeitslos, die Siedlung blieb. Was ich noch nicht ahnen konnte: meine Widerständigkeit sprach sich bei den gerade gegründeten Grünen herum und verschaffte mir anderthalb Jahre später einen Listenplatz für ein Bundestagsmandat.